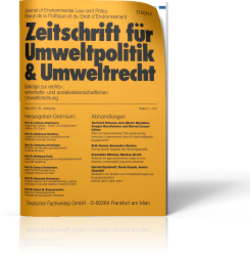
„Resilienz im interdisziplinären Dialog“ – Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht
Veröffentlicht am: 01.12.2023
Weiteres:
Resilienz ist in aller Munde und wird nicht nur in den Sozialwissenschaften (Bröckling 2017; Endreß/Maurer 2015; Endreß/Rampp 2022; Karidi et al. 2018), sondern auch darüber hinaus breit diskutiert (Curt/Tacnet 2018; Wieland/Durach 2021; Rana 2020; May et al. 2018 u. 2022). Mit Blick auf die steile Karriere des Resilienzbegriffes in den letzten Jahren, der sich in ganz unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen erkennen lässt, stellt sich die Frage, ob Resilienz lediglich ein akademisches “buzzword” darstellt oder es sich hierbei tatsächlich um einen “Paradigmenwechsel im Umgang mit Unsicherheit” (Bonß 2015: 16) handelt. Für die wachsende Bedeutung des Resilienzbegriffes lassen sich unterschiedliche Gründe anführen. Ein wesentlicher Aspekt ist das Auftauchen neuer, hochgradig entgrenzter und interdependenter Risiken und Unsicherheiten. Die daraus resultierende Komplexitätserhöhung korrespondiert dabei mit einer verringerten Kontrollierbarkeit (Beck 2007). Die Ungewissheit über mögliche zukünftige Entwicklungen avanciert auf diese Weise zu einem bestimmenden Merkmal in einer von Nichtwissen geprägten Welt.
Die “multiplen Krisen” der Gegenwart (Klima, Energie, Krieg, Covid-19, Inflation, Populismus, . . .) scheinen einen grundlegend modifizierten Umgang mit Risiken und Unsicherheiten zu erfordern. Dabei ist Resilienz eine Möglichkeit, Krisen auf andere Art und Weise zu begegnen. Eine Besonderheit von Resilienz ist, dass “vermehrt die Bewältigung, nicht das Verhindern von Schadensereignissen ins Zentrum sicherheitspolitischer Überlegungen” (Dunn Cavelty/Prior 2013: 1) rückt. Denn wenn sich das Eintreten unerwünschter Ereignisse nicht prognostizieren und verhindern lässt, sollen zumindest Strategien für die Bearbeitung dieser Ereignisse bereitstehen. In diesem Kontext wird Resilienz zur notwendigen Kompetenz im Umgang mit Krisen, und zwar in Bezug auf Individuen, soziale Gruppen, Staaten, politische und ökonomische Systeme sowie (supranationale) Organisationen gleichermaßen. So finden sich beispielsweise Ratgeber und Anleitungen zur Stärkung individueller Resilienz genauso wie außen- und sicherheitspolitische Strategiepapiere der Europäischen Union, die sich inzwischen hauptsächlich auf Resilienz beziehen (Bendiek 2017). Während Fragen individueller Resilienz maßgeblich in der Psychologie diskutiert werden, spielen Überlegungen zu kollektiver und/oder staatlicher Resilienz vor allem in der Politikwissenschaft und den Internationalen Beziehungen eine wichtige Rolle.
Doch was genau bedeutet Resilienz im Kontext verschiedener Disziplinen und welche analytischen, aber auch normativen und politischen Perspektiven und Fragen

