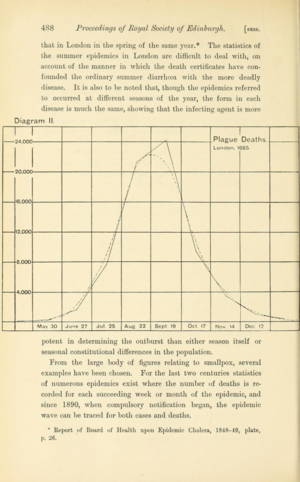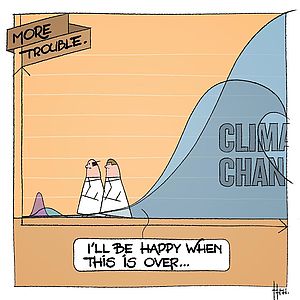BLOCH'NOTES NEWSLETTER | Special COVID-19 November 2020
Es ist bei Weitem noch nicht Zeit, Bilanz zu ziehen in diesem Sommer 2020. In dem Wissen, dass das Virus selbst keine Ferien macht, ist es dennoch ein Moment des Innehaltens, um auf das vergangene halbe Jahr zurückzublicken, das sich noch zu Anfang des Jahres sicherlich niemand in dieser Form ausgemalt hat. Auch am Centre Marc Bloch haben Covid-19 und der Lockdown zu einschneidenden Veränderungen geführt und zahlreiche Umstellungen und Anpassungen nach sich gezogen. Angesichts der aufkommenden Krise haben wir bereits am 13. März eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Centre zu schützen und soweit es geht von zuhause aus zu arbeiten. In den nächsten Wochen haben wir dann gelernt, unsere Aktivitäten im Kontext der aktuellen Gesundheitskrise neu zu organisieren. Als ein geistes- und sozialwissenschaftliches Forschungszentrum, das aktuelle Entwicklungen zeitnah perspektiviert, stellte sich für uns sofort auch die Frage nach den vielfältigen Auswirkungen der „Corona-Krise“ auf unsere Gesellschaften. Gerade in einer Zeit fortdauernder Ungewissheit sahen und sehen wir es als unsere Aufgabe an, einen Beitrag zur kritischen Betrachtung des außergewöhnlichen Moments zu leisten, den die Welt derzeit durchlebt. Jenseits rascher Reaktionen im Modus von Notfall und Dringlichkeit bedurfte und bedarf dies auch immer wieder Augenblicken des Nachdenkens, um über unsere konkreten Forschungspraktiken, unsere Themen und Methoden sowie deren Weiterentwicklung zu reflektieren.
Da Präsenzveranstaltungen, öffentliche zumal, nicht mehr möglich waren, haben wir eine auf eine breite Öffentlichkeit zielende Webseminarreihe organisiert, die unter dem Titel „Systemrelevant? Was die Krise mit unserer Gesellschaft macht. Deutsch-französische und europäische Perspektiven“ Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichen Disziplinen und Ländern zusammenbringt, um die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Gesellschaften auf der Basis ihrer Forschungen zu diskutieren. Im zurückliegenden Semester haben auf diese Weise fünf kommentierte Vorträge stattgefunden (die auch noch nachträglich als Videos auf unserer Webseite angesehen werden können). Das Themenspektrum reichte von Demokratiefragen in Ostmitteleuropa (Balázs Trencsényi, kommentiert von Leyla Dakhli und Marc Lazar) über organisationssoziologische Aspekte des Gesundheitsmanagements in Frankreich (Henri Bergeron und Olivier Borraz, kommentiert von Jérémy Geeraert) oder der transnational vergleichenden Analyse der ersten dreißig Tage des Corona-Managements (Paul-André Rosental, kommentiert von Jürgen Kocka und Franziska Zumbaum-Fischer) bis hin zu ethnographischen (Frédéric Keck, kommentiert von Tanja Bogusz) sowie medizin- und emotionshistorischen Perspektiven (Bettina Hitzer, kommentiert von Emmanuel Delille) auf die von dem Virus ausgelöste weltweite Krise. Für das kommende Semester planen wir bereits weitere Vorträge, die den Blick etwa auf Fragen der globalen Wirtschaftspolitik, der Demokratie oder auch der Erinnerungskultur weiten sollen.
Neben diesen Seminarveranstaltungen haben wir eine eigene, auf unserer Homepage veröffentlichte Artikelserie begonnen, mit dem Titel „Gesellschaft im Krisenmodus: Geistes- und sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Corona“. Seit Anfang April werden dort in loser Folge meist kurze Beiträge unserer Forscherinnen und Forscher publiziert, die sich aus der Sichtweise ihrer jeweiligen Disziplinen mit der Situation auseinandersetzen und nach den Auswirkungen der „Corona-Krise“ auf unsere Gesellschaften fragen.
Die ersten drei Beiträge suchen die gegenwärtige Krise aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu historisieren: Paul Franke, Martin Herrnstadt und Léa Renard zeigen in ihrem wissensgeschichtlichen Beitrag, dass die „Politik der Kurve“ mit ihren Grafiken und Statistiken ebenso wie Wissensproduktion als solche niemals neutral und kontextunabhängig sein kann. Mit der Epidemiologie betrachtet Emmanuel Delille eine Disziplin, die neben der Virologie eine zentrale Rolle im aktuellen Krisenmanagement spielt. Denis Thouard hat gleich zu Beginn der Krise La Peste von Albert Camus einer coronabedingten Relektüre unterzogen. Die drei folgenden Artikel betrachten Covid-19 aus sozial- und politikwissenschaftlicher Sicht: In einer transnationalen und vergleichenden Perspektive fragen Olivier Giraud und Nikola Tietze nach den Auswirkungen auf gesundheits- und sozialpolitische Solidaritäten in Europa und darüber hinaus. Während Andrea Kretschmann den Zusammenhang von worst-case-Szenarien und Grundrechtsfragen in den Blick nimmt, untersucht Jérémie Gauthier das Auftreten und die Praxis der Polizei in den „quartiers populaires“ während des „état d’urgence sanitaire“. Die beiden letzten Beiträge schließlich lenken den Blick auf die weiterhin zentralen Fragen von Ökologie, Klima und Ressourcen im Kontext der Krise. Judith Nora Hardt beleuchtet die Bezüge zwischen Covid-19 und der Klimadebatte. Sophie Lambroschini betrachtet das Zusammenwirken multipler Krisen um Sicherheit, Ressourcen und Corona im Kontext des Ukraine-Konflikts.
All diese Beiträge ergeben also ein vielfältiges, wenn auch selbstredend keinesfalls vollständiges Bild der sozial- und geisteswissenschaftlichen Sicht auf Covid-19, das wir in diesem Newsletter noch einmal abbilden möchten. Dabei haben wir die Texte größtenteils in ihrem ursprünglichen Zustand belassen und das Datum ihrer Erstveröffentlichung angegeben. Gerade weil sich die Gesundheitskrise dynamisch entwickelt und wir manche Aspekte vom heutigen Standpunkt aus vielleicht anders einschätzen, als wir es vor einigen Monaten getan haben und sicherlich auch in Zukunft tun werden, bietet die Zusammenschau, so hoffen wir, eine interessante Momentaufnahme und erlaubt es auch, unsere eigenen wissenschaftlichen Beobachtungen fortlaufend zu aktualisieren und zu perspektivieren. Unser „Newsletter Extra“ zu Covid-19 versteht sich also zugleich als Zwischenbilanz und Zeitdokument, das hoffentlich in der Rückschau zum kritischen Nachdenken anregt. Allen Autorinnen und Autoren, die sich an diesem Unternehmen beteiligt haben, danken wir sehr herzlich, ebenso wie dem Redaktionsteam dieses Hefts um Lucie David, Sara Iglesias, Chloé Risbourque und Sébastien Vannier.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Centre und den besten Wünschen für eine hoffentlich gesunde rentrée wünschen wir eine anregende Lektüre.
Katia Genel, Silke Mende und Jakob Vogel
Berlin, im Sommer 2020
En cet été 2020, il est encore trop tôt pour faire le bilan. Nous savons bien que le virus lui-même ne prend pas de vacances, mais ce moment de pause permet cependant de reconsidérer ce dernier semestre que personne n’aurait sans doute pu imaginer sous cette forme en début d’année. La Covid-19 et le confinement ont amené des changements importants qui ont affecté aussi le Centre Marc Bloch et provoqué dans notre institution de nombreuses restructurations et adaptations. En raison de la crise qui débutait, nous avons dès le 13 mars mis en place une série de mesures pour protéger les employé.e.s du Centre et commencé à travailler, dans la limite du possible, à domicile. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons appris à réorganiser nos activités dans ce nouveau contexte de crise sanitaire. En tant que centre de recherche en sciences sociales et humaines qui vise à analyser les événements actuels selon différentes perspectives, s’est évidemment posé à nous la question des nombreuses conséquences de cette crise du coronavirus sur nos sociétés. Nous considérions, et considérons toujours, en particulier en cette période d’incertitude persistante, comme notre devoir d’apporter notre contribution à l’observation critique de ce moment exceptionnel que le monde entier traverse actuellement. Au-delà des réactions à chaud, dans l’urgence, cette situation nécessitait et nécessite encore un temps de réflexion afin d’interroger nos pratiques concrètes de recherche, nos thèmes et nos méthodes.
Puisque les manifestations scientifiques publiques n’étaient plus possibles dans les locaux du CMB, nous avons organisé une série de séminaires en ligne à destination du grand public, que nous avons intitulée « Essentiel à la société ? Les effets sociaux de la crise. Perspectives franco-allemandes et européennes. » Ce cycle réunissait des chercheuses et chercheurs de différentes disciplines et de différents pays pour discuter des effets de la pandémie sur nos sociétés sur la base de leurs propres recherches. Au cours du dernier semestre, le CMB a pu ainsi organiser cinq conférences dans le cadre de ce cycle, dont les vidéos sont disponibles sur notre site Internet. La palette des sujets abordés allait des questions de démocratie en Europe centrale et orientale (Balázs Trencsényi, commenté par Leyla Dakhli et Marc Lazar), à une approche de sociologie des organisations de la gestion sanitaire en France (Henri Bergeron et Olivier Borraz, commentés par Jérémy Geeraert) ou une perspective transnationale comparative de la gestion des 30 premiers jours du coronavirus (Paul-André Rosental, commenté par Jürgen Kocka et Franziska Zumbaum-Fischer). Mais également une approche de cette crise mondiale provoquée par le virus par l’ethnographie (Frédéric Keck, commenté par Tanja Bogusz) et par l’histoire de la médecine et des émotions (Bettina Hitzer, commentée par Emmanuel Delille). Pour le semestre prochain, nous avons déjà prévu d’autres conférences dans ce même cadre qui porteront sur les aspects de politique économique, de démocratie mais aussi de culture de la mémoire.
Au-delà de ce cycle de séminaires, nous avons publié également sur notre site Internet une série d’articles intitulée « La société en temps de crise : perspectives de sciences humaines et sociales sur le Corona ». Depuis début avril, nos chercheuses et nos chercheurs ont publié, des articles qui offrent souvent de manière courte et informelle, une première analyse de la situation du point de vue de leurs disciplines et interrogent les conséquences de la crise du coronavirus sur nos sociétés.
Les trois premières contributions ont pour objectif d’historiciser la crise actuelle : dans leur article « Politik der Kurve », Paul Franke, Martin Herrnstadt et Léa Renard montrent, sous l’angle de l’histoire des sciences, que les graphiques, statistiques et la production du savoir ne peuvent en soi jamais être neutres et détachés de leur contexte. Emmanuel Delille se penche ensuite sur l’épidémiologie, une discipline qui, à côté de la virologie, joue un rôle central dans la gestion de crise actuelle. Denis Thouard a commenté, dès le début de la crise, sa relecture de La Peste d’Albert Camus. Les trois articles suivants s‘intéressent à la crise de la Covid-19 sous l’angle des sciences politiques et sociales. Dans une perspective transnationale et comparative, Olivier Giraud et Nikola Tietze posent la question des conséquences sur les solidarités sanitaires et sociales en Europe et dans le monde. Andrea Kretschmann s’intéresse aux liens entre les worst-case scénarios et les questions des droits fondamentaux. Jérémie Gauthier étudie la présence et les pratiques de la police dans les quartiers populaires pendant l’état d’urgence sanitaire. Les deux derniers articles de ce chapitre sont consacrés aux questions centrales de l’écologie, du climat et des ressources dans le contexte de la crise. Judith Nora Hardt met en avant les liens entre les débats soulevés par la Covid-19 et ceux liés au changement climatique. Sophie Lambroschini observe les interactions entre les multiples crises de la sécurité, des ressources et du coronavirus dans le contexte du conflit ukrainien.
Toutes ces contributions permettent de mettre en avant une première esquisse très diversifiée, et évidemment pas encore une image complète, de la perspective des sciences humaines et sociales sur la Covid-19 telle que nous essayons de la présenter dans cette Newsletter. Nous avons laissé les textes en grande partie dans leur version originale et indiqué la date de la première publication. Cette crise sanitaire évolue de façon très dynamique, de telle sorte que nous pourrions aujourd’hui évaluer certains aspects bien différemment de ce que nous avons proposé il y a quelques mois, et ce sera certainement encore le cas concernant les évolutions futures. C’est pour cela que ce recueil propose, nous l’espérons, un instantané intéressant et permet d’actualiser en permanence et de mettre en perspective nos propres observations scientifiques. La Newsletter que nous consacrons à la Covid-19 est donc à considérer comme un bilan provisoire et un document d’époque qui permettra à l’avenir une réflexion critique. Nous remercions chaleureusement toutes les chercheuses et tous les chercheurs qui ont participé à cet ouvrage, ainsi que l’équipe de rédaction de cette Newsletter, Lucie David, Sara Iglesias, Chloé Risbourque et Sébastien Vannier.
Très bonne lecture et tous nos vœux de santé pour cette rentrée de la part du Centre Marc Bloch.
Katia Genel, Silke Mende und Jakob Vogel
Berlin, été 2020
Politik der Kurve: Wissenshistorische Perspektiven auf Produktion und Kommunikation statistischer Evidenz.
Eine erste Version des Beitrags wurde am 04.06.2020 im Seminar des Forschungsschwerpunkts „Dynamiken und Erfahrungen der Globalisierung“ vorgestellt. Die Autori*innen bedanken sich bei den Teilnehmenden für wertvolle Kommentare.
Léa Renard
Léa Renard ist Soziologin und forscht zu statistischen Kategorisierungen von Migration und Arbeit aus historisch-soziologischer Perspektive. Sie ist seit 2014 am Centre Marc Bloch assoziiert, wo sie den Schwerpunkt „Dynamiken und Erfahrungen der Globalisierung“ ko-organisiert. Seit Januar 2020 ist sie Post-Doktorandin im DFG-Projekt „Der globale Wandel der Kategorie ‚Zwangsarbeit‘. Klassifizierung und Vergleich der Deutungsmodelle der Arbeitswelt in der International Labour Organization (ILO), 1919-2017“ (Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin & Universität Potsdam). Von ihr erschien zuletzt u.a.: „La statistique internationale comme instrument de globalisation ?“ (mit Th. Wobbe, Revue française de sociologie, 2019, 60, 4); Categories in Context. Gender and Work in France and Germany, 1900-Present (Hg. I. Berrebi-Hoffmann, O. Giraud, L. Renard und Th. Wobbe, 2019, Berghahn Books).
Martin Herrnstadt
Martin Herrnstadt ist Wissenschaftshistoriker und forscht zur Geschichte der europäischen Geistes- und Sozialwissenschaften von der Frühen Neuzeit bis in die Moderne mit einem Schwerpunkt auf der Wissensgeschichte der öffentlichen Wohlfahrt. Er ist Postdoc-Fellow am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz und seit 2019 assoziierter Forscher am Centre Marc Bloch. Seine Monographie Menschenbeobachtung und Selbstverwaltung. Joseph-Marie de Gérando und das nachrevolutionäre Selbst 1799-1813 erscheint Ende 2020 in der Reihe Historische Wissensforschung (Mohr Siebeck).
Paul Franke
Paul Franke ist Historiker und forscht zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Er ist seit 2019 Postdoc-Forscher am Centre Marc Bloch und Teil des Forschungsschwerpunktes „Dynamiken und Erfahrungen der Globalisierung“. Sein Forschungsschwerpunkt ist neben der Konsum- und Stadtgeschichte die Geschichte krimineller und informeller Ökonomien in der Moderne. Sein Beitrag “Gambling in the Kitchen – Monte Carlo from the nineteenth to the mid-twentieth century” im The Casino Games and Classic Card Games Reader, Vol. I der Reihe Play Beyond the Computer (hg. von Marc Johnson , 2021, Bloomsbury) befindet sich im Druck.
I - Vom Slogan zum Begriff: oder von der Biomacht zur Frage staatlicher Evidenzproduktion
Die Rede von Biomacht, Biopolitik und Ausnahmezustand ist in aller Munde. Seien es die Slogans, mit denen in deutschen Innenstädten die Abschaffung der „Corona-Diktatur“ und „Zwangsimpfungskampagnen“ gefordert wird, oder die dystopischen Visionen einiger Publizisten aus diversen Lagern, die das Aufkommen der „immunitären Gesellschaft“ heraufbeschwören, die die Menschen mithilfe einer „pharmapornographische“ Unterwerfungsmaschinerie in ihre „häuslichen Telegefängnisse“ einsperrt.[1]
Im Brennpunkt dieser Auseinandersetzungen um die Legitimität staatlicher Zwangsgewalt stehen vor allem Statistiken und verschiedene Formen statistischer Evidenzproduktion, von #flattenthecurve bis zu R-oder k-Werten. Dieser Kampf um Evidenz oder Zweifelhaftigkeit dessen, was statistische Daten zum Ausdruck bringen, seien es nun Fallzahlen, Mortalität oder Infektiösität des Virus, ist indes exemplarisch für einen Grundsatzkonflikt, der liberale Gesellschaftsformationen spätestens seit dem 19. Jahrhundert durchzieht.[2] Während für die liberale Wirtschaftsordnung die freie Selbstbestimmung und die Autonomie des Individuums als höchstes Gut postuliert wird, tritt zu Zeiten von Epidemien und Pandemien die Tatsache der physiologischen Fremdbestimmung und der Notwendigkeit zentraler Steuerung der Einzelnen nicht als Individuen, sondern als potenzielle Population von Überträgern in den Blick. Die Kritik, die derzeit mit dem Slogan der Biomacht kolportiert wird, ist daher nicht nur nichts Neues, sondern sollte als Symptom einer Spannung verstanden werden, die industrialisierte Demokratien von Beginn an inhärent ist. Zum anderen ist der Verweis auf Biomacht, wie sich mit Philipp Sarasin[3] sagen lässt, zu unspezifisch. Anstatt von allmächtiger und amorpher Biomacht zu sprechen, ist es vielversprechender, sich die Funktionen und Grenzen dieses überindividuellen Zwangsapparates Staat, sein Verhältnis zur Wissenschaft, sowie die Techniken und Medien der Evidenzproduktion und Evidenzkommunikation im Detail anzusehen und ihre Rolle im Prozess staatsbürgerlicher Subjektivierung zu diskutieren. Die Staatstheorie von Thomas Hobbes erlaubt es, begriffliche Überlegungen zur Rolle wissenschaftlicher Evidenzproduktion für die Konstruktion moderner Staatlichkeit anzustellen. Von hier aus wenden wir uns der Geschichte der Kurve als Technik zur Herstellung statistischer Evidenz in Epidemiologie und Wirtschaftsprognostik zu. Sie ermöglicht, abschließend einen Blick auf die Herausforderungen gegenwärtiger Wissenschaftskommunikation und Evidenzproduktion zu werfen.
Hobbes und die Gemachtheit von Repräsentation als Bedingung ihrer Intelligibilität
Lange vor den Debatten über Bevölkerungspolitik im 19. Jahrhundert ist die Geschichte politischer Souveränität mit der Sorge des Staates um das Leben seiner Subjekte verknüpft.[4] Im Leviathan geht Hobbes bekanntlich von der radikalen körperlichen und geistigen Gleichheit aller Menschen aus. Der Schwächste ist stark genug, den Stärksten zu töten,[5] schreibt Hobbes und es sind die geteilte Einsicht in die eigene Schwäche und die rationale Angst vor dem gewaltsamen Tod, die das Interesse zur Übertragung individuellen Souveränität an ein überindividuellen und artifiziellen Souverän liefert. Der springende Punkt der Hobbes‘schen Staatstheorie besteht nun darin, dass die Unterordnung der Subjekte Ergebnis eines intellektuellen wie auch affektiven Kalküls ist. Aus der Einsicht in ihre rationalen und affektiven Gründe heraus übertragen die Subjekte ihre Souveränität, behalten sich aber das Recht vor, dem Souverän seine Autorität auch wieder zu entziehen. Damit dieses Recht in Anspruch genommen werden kann, muss der Einzelne – so schreibt Hobbes – allerdings die Möglichkeit besitzen, Handlungen und Diskurse des Souveräns auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Hobbes' zentraler Begriff, um dieses neue Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem Souverän zu bezeichnen, ist Repräsentation.
Dieses neue Verhältnis wirft zwei grundlegende Fragen auf: Wie sollte ein Staat Repräsentation produzieren, bzw. was ist der richtige Umgang mit der Evidenz der Wörter, Zeichen und Zahlen seitens des Souveräns; die zweite und komplementäre Frage ist: Wie lassen sich Zeichen lesen, bzw. welche Fähigkeiten müssen die Subjekte besitzen, um politische und wissenschaftliche Zeichen verstehen und im Verhältnis zu ihren Interessen und rationalen Ängsten interpretieren zu können?
Hobbes unterscheidet grundsätzlich zwei Formen der Repräsentation. Eine, die er aus der Geschichte der antiken Philosophie und des Christentums herleitet sieht und als Dämonologie bezeichnet, und eine andere, die er mit seinem Buch zu begründen sucht und die als Epistemologie bezeichnet werden kann. Diese zwei Perspektiven auf Wissensproduktion und Wahrheit sind bei Hobbes mit zwei grundlegend verschiedenen Formen weltlicher Herrschaft verbunden: dem Königreich der Dunkelheit und der Herrschaft des Gemeinwohls, bzw. Common-Wealth. Dem Königreich der Dunkelheit entspricht dabei eine Vorstellung von Repräsentation, die auf Täuschung und Selbst-Täuschung beruht, insofern sie den Glauben erzeugt, die Wörter der Sprache, die Zahlen und die geometrischen Formen seien Abbilder einer außerhalb des menschlichen Verstandes liegenden absoluten Wahrheit der Natur. Menschengemachte Begriffe, Bilder und Phänomene erhalten eine von den Menschen unabhängige Existenz und Autorität. Die Regierenden dieser Schattenwelt machten, so Hobbes, mit Hilfe einer Affektlehre – der Dämonologie[6] – von den so hergestellten Idolen systematischen Gebrauch. Was Hobbes dem dämonologischen Verständnis von Wahrheit gegenüberstellt, ist die Vorstellung von wissenschaftlicher Wahrheit als menschengemachter Konstruktion. Wissenschaft und Wahrheit kann es für Hobbes nur von den Dingen geben, die wir selbst hervorgebracht haben, daher sind für ihn auch Mathematik und Politik die einzigen beiden Wissenschaften, die strenge Beweise hervorbringen können. Das Umschlagen vom Zeichen zum Fetisch, von Epistemologie zu Dämonologie, verhindert eine Praxis der Repräsentation, die stets ihre Gemachtheit sowohl als Konstrukt menschlicher Einbildungskraft (Imagination) als auch als materielles Objekt mit ausstellt. Evidenz zu erzeugen, kann dann für Hobbes nicht heißen, Repräsentationen zu produzieren, die wie Götzen verehrt werden. Im Gegenteil, die Evidenz einer Repräsentation setzt das Offenlegen ihres arbiträren Charakters voraus, um dadurch die Lesbarkeit des Staates durch seine Subjekte wie auch deren rationale Unterwerfung unter das Gemeinwohl zu ermöglichen. Hobbes' Verständnis wahrhafter Repräsentation ist für uns von Interesse, weil sie dem Alltagsverständnis unserer medialen Debatten so fundamental widerspricht. Wird in unserer medialen Kultur jede Gelegenheit genutzt, um den Wahrheitsgehalt wissenschaftlicher Tatsachen durch den Aufweis ihres konstruierten oder konventionellen Charakters zu schwächen, so erlaubt es das Beispiel von Hobbes, eine Wissenskultur zu denken, in der Wissensansprüchen solide sind, insofern sie als Konstrukte erscheinen und bestimmten Konventionen folgen.[7] Anders gesagt, Evidenz ist für Hobbes nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Funktion einer Übereinkunft. Eines der wirkmächtigsten Medien staatlicher Souveränität zur Herstellung dieser Übereinkunft ist die Zahl.
Von den Sterbetafeln zur epidemiologischen Überwachung (1600-1900)
Zahlen kann man in Anlehnung an Bettina Heintz als Kommunikationsmedien verstehen.[8] Im Laufe der Institutionalisierung und Professionalisierung der Wissenschaften in der Frühen Neuzeit mussten lokale, qualitative Beobachtungen transparent darstellbar und intersubjektiv kommunizierbar werden, um Distanzen zu überbrücken und so Erkenntnisse mit Korrespondenten austauschen zu können. Für diese Art von wissenschaftlichem Austausch eignen sich Zahlen als Konventionen und Grafiken als Darstellungen. Die Einhaltung von Standards in der Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse gewährt somit ihre Kommunikation. Eine lokal entstandene Beobachtung wird im Medium der Zahl transportiert und kommuniziert – und damit objektiviert. Im Folgenden zeigen wir am Beispiel der Entstehung der Vitalstatistik und der Epidemiologie, wie die Konstruktion von Evidenz, gestützt auf Zahlen und Grafiken, funktionieren kann.
Mit Biopolitik meinte Foucault den „Eintritt des Lebens in die Geschichte“.[9] Damit beschreibt er einen Paradigmenwechsel in der Wissensgeschichte: Reine Listen von Toten und Lebenden gab es in Europa schon sehr lange (spätestens ab dem 16. Jahrhundert systematisch mit den Kirchenbüchern). Erst zwischen 1750 und 1800 wurde damit begonnen, Leben und Tod und damit auch die Bevölkerung als dynamische Größen zu verstehen, deren Entwicklung, Fortschritt, Bewegung mit neuen Regierungstechnologien wie der Statistik dargestellt wurde. Diese Entwicklungen lassen sich an der Entstehung der Vitalstatistik und der Epidemiologie in Großbritannien zwischen 1600 und 1900 nachzeichnen. Das Ziel dieser neuen Wissenschaften war die „Domestizierung des Todes“, indem dem Tod als Ereignis eine „messbare Wahrscheinlichkeit“ zugeschrieben wurde.[10] In Großbritannien ist das Aufkommen und die Systematisierung der Sterbetafeln in der Frühen Neuzeit eng mit den Pest-Ausbrüchen verbunden: In vielen Beerdigungslisten um 1600 wurden Todesfälle, die der Pest zugeschrieben wurden, separat gezählt.[11] Dabei ging es nicht darum, nach allgemeinen Mustern und Bedingungen zu suchen, sondern vor allem darum, ein Verzeichnis der Epidemie aufzustellen, um die betroffenen Städte bzw. Bezirke meiden zu könnnen.
Die Vitalstatistik des 19. Jahrhunderts unterscheidet sich von den ersten Sterbetafeln in mindestens zwei Hinsichten: Erstens werden Statistiken nun auch für ein breiteres Publikum zugänglich und veröffentlicht, sie gelten nicht mehr als Staatsgeheimnis[12]; zweitens werden mathematische Modelle und Verfahren für die Berechnung von Wahrscheinlichkeit erprobt und entwickelt.[13] Mitte des 19. Jahrhunderts – noch bevor Louis Pasteur und Robert Koch die genauen Ursachen für Erkrankungen und Epidemien entdeckten – konnte der britische Mediziner und Statistiker William Farr (General Register Office) Regelmäßigkeiten hinter der Ausbreitung von Epidemien und schließlich ein Gesetz identifizieren, indem er die Zahlen vergangener Epidemien in verschiedenen Städten verglich und mit dem mathematischen Modell der Normalverteilung in einen Zusammenhang brachte. Dies wurde in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts von John Brownlee (UK Medical Research Committee) bildlich dargestellt.[14] Hiermit materialisiert sich die Epidemie in Form der Kurve und wurde als eigenständige Größe sichtbar. Die Kurve stellt den Verlauf einer Epidemie dar, der zeitlich begrenzt ist. Somit verschwindet die Epidemie zwar nicht, aber sie wird in ihrer Wahrscheinlichkeit zumindest greifbar, erfahrbar und schließlich vorhersehbar: „Die Strategie #flattenthecurve bedeutet, mit dem Erreger zwar zu rechnen, zu wissen, dass er nicht auszurotten ist, seine Verteilung über die Zeit aber so zu ‚strecken‘, dass das Gesundheitssystem mit ihm umgehen kann.“[15] Mithilfe von Grafiken werden politische Entscheidungen, die durch bestimmte Handlungsanweisungen von den Individuen realisiert werden müssen, legitimiert und kommuniziert.[16]
II
Wirtschaftsprognosen: Die Zukunft und ihre optische Produktion
Diese Geschichte der statistischen Erfassung von Epidemien zeigt, wie sie von einem unfassbaren zu einem scheinbar kalkulierbaren Ereignis wurde. Die Kurve, die sich weiterzeichnen lässt, macht sie messbar und suggeriert damit auch eine Beherrschbarkeit.
Im 20. Jahrhundert gab es ein weiteres Feld, in dem Prognosen, Voraussicht und Messbarkeit an Bedeutung gewann: die Wirtschaft. Auch in der Corona-Pandemie wurde im Verlauf der Wochen und Monate das ökonomische Wachstum (oder der Mangel daran) zu einer der weitreichenden Konsequenzen. Negative Prognosen für die nächsten Jahre und das Bangen um baldiges Wachstum lenken die Blicke vom R-Wert und der Kurve der Neuinfektionen auf die Zahlen, die die Politik schon weitaus länger prägen: Wachstum und Neuverschuldung. Dabei ist auch die Geschichte der Wirtschaftsprognose vom Ringen um Evidenz, von der Erfahrung des Scheiterns und der Konkurrenz von Modellen und Methoden gekennzeichnet.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts, als Aktien an Bedeutung gewannen, wuchs auch die Bedeutung der Vorhersage für die Wirtschaft im Allgemeinen. Interessant ist dabei, dass die Modelle oft Metaphern, Veranschaulichungen und Grafiken aus der Meteorologie nutzten. Es wurde „gemessen“, Werte auf „Barometern“ verzeichnet, wirtschaftliche Daten als „Temperaturen“ und „Druck“ dargestellt.[17] Es zeigt sich, dass die Produktion wirtschaftlicher Daten den Bezug auf die mechanische Methode der Wettervorhersage brauchte, um Evidenz beanspruchen zu können. Ähnlich wie in der Seuchen- und Gesundheitspolitik waren es Krisen, die zu einem Ausbau der Prognose und Erfassung führten. Die Wirtschaftskrise 1907 führte in den USA zu einem rasanten Ausbau der Wirtschaftsprognose, ihrer Institutionen und Methoden.[18]
Vor allem das „Harvard Barometer“ von 1919 genoss hohes Vertrauen und Interesse der Zeitgenossen. Das lag nicht zuletzt an der Methode, mit der Warren M. Persons und die Harvard Gruppe ihre Graphen und Kurven erstellten. Sie beanspruchten „mechnical objectivity“.[19] Sie verzichtet auf qualifizierende Adjektive, die andere Barometer nutzten, in denen die Ökonomie „depressed“ oder „feverish“ war. Diese Visualisierung zeigte Anstieg und Abfall von Graphen, die in Beziehung standen, keine Schlüsselwörter, die eine Agenda der Ersteller vermuten ließen. Persons und seine Mitarbeiter gliederten die wirtschaftlichen Aktivitäten in drei Kurven: Aktivitäten an der Börse A, B für die Warenmarktlage und C für die Situation am Geldmarkt. Anschließend wurde beobachtet, dass die drei Kurven zeitversetzt, aber in der gleichen Reihenfolge ihre Höhepunkte hatten. Die Harvard Gruppe nutzte zur Erstellung der Graphen und zur Berechnung ihrer Korrelation ein striktes Protokoll, dass den Einfluss der Ersteller minimieren sollte und so den scheinbar mechanischen Charakter noch verstärkte. Der zyklische Verlauf der Kurven und ihre Beziehung untereinander schien die Wirtschaft prognostizierbar zu machen. Als Instrument der Konjunkturprognose wurde dieses Modell enorm einflussreich, auch international. In Südamerika, Australien und Europa entstanden Institute, die sich den mechanisch-technischen Ansatz des Harvard Barometers zum Vorbild nahmen.[20] Die Methoden veränderten sich im Laufe der 1920er-Jahre noch einmal, doch die Popularität des Modells und der Methode endete abrupt mit 1929, als eine Boom-Periode vorhergesagt wurde. In Wirklichkeit manifestierte sich in diesem Jahr die (bislang) größte Wirtschaftskrise der Moderne.[21]
Die Geschichte des Harvard-Barometers und der Wirtschaftsprognose ist trotz dieses spektakulären Scheiterns keine bloße Fußnote der Geschichte, sondern offenbart für die aktuelle Situation interessante Perspektiven: etwa wie Evidenz optisch und durch Methoden hergestellt werden konnte, aber auch wie ein Modell zu einer globalen Vernetzung und Akzeptanz einer statistischen Messmethode avancieren konnte. Beides lohnt sich im Auge zu behalten, wenn der Blick auf die Kurven der Corona-Pandemie gerichtet wird.
Evidenzkrise?
Hobbes‘ Forderung nach einer auf dem Konstruktcharakter von Evidenz und Einsicht aufgebauten Politik ist unsere Lebensrealität geworden. Die Rolle, welche die Evidenz der Statistik, der Zahlen und Grafiken für das Vertrauen spielen, das wir Politikern, Virologen, oder Ökonomen entgegenbringen, kann dabei schwer überschätzt werden. Statistik ist Medium der Standardisierung und Kommunikation innerhalb der Wissenschaft, da sie Vergleichbarkeit zwischen diskreten wissenschaftlichen Beobachtungen herstellt und eine gemeinsame Sprache begründet. Sie ist zudem, wie die Geschichte der Kurve im 19. Jahrhundert und das Beispiel John Brownlees zeigt, ein wissenschaftliches Beobachtungsinstrument eigenen Rechts, das die grafische Rekonstruktion von Verlaufsformen ermöglicht und Zukunftserwartungen definiert. Neben der Epidemiologie ist die Kurve zur selben Zeit ein Instrument ökonomischer Prognostik, ein Konsumprodukt, das zugleich auch Instrument zur Steuerung individuellen Verhaltens ist. Am Beispiel der Kurve als einer bestimmten Form statistischer Evidenzproduktion werden die Ausdifferenzierung und Ausbreitung zahlengestützter Evidenzpraktiken und ihre diversen epistemischen und ästhetischen Formen sehr gut greifbar.
Was sich demgegenüber nicht im selben Maße realisiert hat, wie es sich Hobbes möglicherweise erhoffte, ist die subjektiv-intelligible Seite dieser Evidenzproduktion. Stand bei Hobbes noch der Kampf zwischen Epistemologie und Dämonologie als Kampf zwischen Licht und Dunkelheit im Vordergrund, so hat die ubiquitäre Rede von der Wissensgesellschaft ihrerseits womöglich eine neue Form der Dunkelheit mit sich gebracht. Die Herausbildung eines Urteils der Staatssubjekte über die Auswirkungen einer Pandemie, seien sie medizinisch oder wirtschaftlich, vollzieht sich heutzutage im Angesicht einer Vielzahl miteinander konkurrierender Formen der Evidenzproduktion. Die schiere Verfügbarkeit von Wissen bringt als ihre Kehrseite eine Form des Unwissens mit sich, die von Studien zur Post-Faktizität als „epistemische Erschöpfung“ bezeichnet wird.[22] Diese Erschöpfung ist das Ergebnis eines steten Angriffs auf die Institutionen, die es zur Aufgabe haben, Wissen und Evidenz her- und zur Diskussion zu stellen. Das Ziel dieser Angriffe ist dabei nicht, Prozesse der Wissens- oder Evidenzproduktion zugänglicher zu gestalten, sondern das kognitive und kritische Vermögen der Subjekte abzulenken und zu schwächen. Das Resultat einer solchen Unwissenskultur hat Hannah Arendt einst als eigentümliche Mischung aus „Zynismus“ und „Leichtgläubigkeit“ bezeichnet: eine unheilvolle Haltung, der gleichzeitig alles möglich und nichts wahr erscheint.[23]
Wenn in den aktuellen Debatten oft das „Versagen“, die „Manipulation“ oder der „Evidenz-Betrug“ der Wissenschaft in der sogenannten Gesundheitskrise kolportiert wird, sind die Beweise dafür meist gegensätzliche Stimmen und Statements von Epidemiologen, Virologen, Immunologen etc. Jüngst war dies z.B. an den medialen Angriffen auf die Forschung des Virologen Christian Drosten zu beobachten. Was sich hinter solchen Attacken und dem mit ihnen gestifteten epistemischen Chaos verbirgt, ist eine Vorstellung von Wissenschaft als absoluter Wahrheitsproduzentin, die wenig mit tatsächlichen Praktiken wissenschaftlicher Evidenzproduktion zu tun hat. Die aktuelle Aufgabe besteht daher nicht darin, das Robert Koch-Institut mit einem veralteten und eigentlich von jeher problematischen Bild starker Wissenschaft als privilegierter und unanfechtbarer Wissensproduzentin zu verteidigen. Vielmehr geht es darum, den aktuellen Moment als Chance zu begreifen, ein realistischeres Bild wissenschaftlicher Wahrheitsproduktion zu präsentieren. Wie lässt sich der Prozess der Ausdifferenzierung von Evidenzpraktiken mit einer Wissenshaltung verbinden, die sich „auf die Vorläufigkeit von Evidenz“[24] und die „Schwäche von Wissen“[25] einzustellen lernt? Wie kann der konstruierte und konventionelle Charakter unseres wissenschaftlichen Weltverständnisses zur Ressource und nicht zum Hindernis seiner gesellschaftlichen und politischen Legitimität werden? Und auf welche Weise lässt sich solch ein differenziertes Verständnis von Wissenschaft mit Formen der Ermächtigung von selbstbestimmtem Handeln verbinden, die für demokratische Wissenskulturen grundlegend sind? Um diese und andere Fragen überzeugend zu beantworten, braucht es Formen von Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit, die Komplexität und Vorläufigkeit nicht als Quelle von Unsicherheit, sondern als Grundprinzipien solider wissenschaftlicher Wahrheitsproduktion erkennen. Am Ende des Tages ist dies aber eine Frage der Politik und der politischen Partizipation und nicht der Wissenschaft.
Fußnoten
[1] Vgl. Pepe Escobar, Nach Corona die Sintflut: Wenn der globale Lockdown vorbei ist, werden die Angriffe auf Mensch und Natur erst richtig beginnen, in: Rubikon, 23. Mai 2020; Paul B. Preciado, Vom Virus lernen 7.4.2020; Christoph Hubatschke, Foucault II: Der Virus und die Biopolitik/-macht, 18. März. 2020; Hermann Ploppa, Neofeudale Experimente, in: Demokratischer Widerstand Nr 5, 16. Mai 2020, S. 4; Hans Springstein, Der Evidenz-Betrug, in: Rubikon, 27. Mai 2020.
[2] Aisenberg, Andrew R. (1999), Contagion. Disease, government and the „social question“ in nineteenth century France. Stanford, Calif.: Stanford University Press; Wagner, Peter (1998): Certainty and Order, Liberty and Contigency. The Birth of Social Science as Empirical Political Philosophy. In: Johan Heilbron, Lars Magnusson und Björn Wittrock (Hg.): The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity. Conceptual Change in Context, 1750-1850. Berlin: Springer Netherland, S. 241-263.
[3] Sarasin, Philipp, Mit Foucault die Pandemie verstehen? Geschichte der Gegenwart, 25. März 2020. URL: https://geschichtedergegenwart.ch/mit-foucault-die-pandemie-verstehen/
[4] Martel, James A. (2007), Subverting the Leviathan. Reading Thomas Hobbes as a radical democrat. New York: Columbia UP, S.139.
[5] Hobbes, Thomas (1996 [1651]): Leviathan. Oxford: Oxford UP, S. 82.
[6] Ebd., Ch. XLV, S. 424ff.
[7] Vgl. für dieses Argument auch: Shapin, Steven und Schaffer, Simon (1984), Leviathan and the air pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life. Princeton: Princeton UP: S. 146-154.
[8] Heintz, Bettina (2007), Zahlen, Wissen, Objektivität: Wissenschaftssoziologische Perspektiven, in Andrea Mennicken und Hendrik Vollmer (Hg.), Zahlenwerk, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften: S. 65–85.
[9] Sarasin, Philipp, Mit Foucault die Pandemie verstehen?, op. cit.
[10] Rohrbasser, Jean-Marc (2009), John Graunt et les bulletins de Londres : une statistique de la mortalité au XVIIe siècle, in: Dix-septième siècle 243(2), S. 345.
[11] Ebd., S. 346.
[12] I. Hacking spricht in diesem Zusammenhang von einer „avalanche of printed numbers“. Vgl. Hacking, Ian (1982), Biopower and the avalanche of printed numbers, in: Humanities in Society 5, S. 279-295.
[13] Hacking, Ian, (1990), The Taming of Chance, Cambridge/New York: Cambridge Univ. Press.
[14] Fine, Paul E. M. (1979), John Brownlee and the Measurement of Infectiousness: An Historical Study in Epidemic Theory, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General) 142(3), S. 347-362.
[15] Sarasin, Philipp, Mit Foucault die Pandemie verstehen?, op. cit.
[16] Vgl. Didier, Emmanuel, Politique du nombre de morts, in: Analyse Opinion Critique, 16. April 2020.
[17] Pietruska, Jamie (2018), Looking Forward. Prediction and Uncertainty in Modern America, Chicago/London: The University of Chicago Press.
[18] Fritsche, Ulrich, Köster, Roman und Lenel, Laetitia (2020), Futures Past. Economic Forecasting in the 20th and 21st Century, Peter Lang.
[19] Lenel, Laetitia (2018), Mapping the Future. Business Forecasting and the Dynamics of Capitalism in the Interwar Period, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 59 (2), S. 377-413. Daston, Lorraine und Galison, Peter (1992) The Image of Objectivity. in: Representations, 40, Special Issue: Seeing Science 81-128, hier: S. 81-83.
[20] Ebd.
[21] Fritsche, Ulrich, Köster, Roman und Lenel, Laetitia (2020), Futures Past, op. cit.
[22] Satta, Mark, Epistemic Tribalism, Epistemic Chaos, and Epistemic Exhaustion, in: The partially examined life. A philosophy podcast and philosophy blog: http://partiallyexaminedlife.com/2018/08/28/epistemic-tribalism-epistemic-chaos-and-epistemic-exhaustion/ (28.08.2018).
[23] „Das Beisammensein von Leichtgläubigkeit und Zynismus war charakteristisch für die Mobmentalität, bevor es eine alltägliche Erscheinung moderner Massen wurde. In beiden Fällen entstand diese Mischung dort, wo Menschen in einer ständig wechselnden und immer unverständlicher werdenden Welt sich darauf eingerichtet hatten, jederzeit jegliches und gar nichts zu glauben, überzeugt, daß schlechterdings alles möglich sei und nichts wahr.“ – Arendt, Hannah (1955): Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, S. 957.
[24] Wie es z.B. prominent von der DFG-Forschergruppe „Evidenzpraktiken in Wissenschaft, Medizin, Technik und Gesellschaft“ (München) gefordert wird. URL: https://www.evidenzpraktiken-dfg.tum.de/
[25] Siehe für einen solchen Ansatz u.a. Epple, Moritz (2020), The Theaetetus Problem: Some remarks concerning a history of weak forms of knowledge, in: Epple, Moritz, Imhausen, Annette und Müller, Falk (Hg.) (2020), Weak Knowledge. Forms, Functions, and Dynamics. Frankfurt am Main: Campus, S. 19-40.
Quand les facteurs de risque ne sont pas intuitifs. L’épidémiologie face à l’histoire
Une version de cet article a été publiée dans la revue Esprit en avril 2020.
Emmanuel Delille
Historien des sciences et de la santé, Emmanuel Delille a mené des recherches sur l’histoire de la psychiatrie, en recourant à la perspective de l’histoire croisée franco-allemande. Il s’intéresse actuellement à l’histoire de l’épidémiologie en Europe et en Amérique du Nord, en particulier au Canada, où il a été Professeur invité, à l'Université du Saskatchewan. Chercheur associé au Centre Marc Bloch, il co-organise les manifestations scientifiques de l’atelier de recherche « Choix sous contraintes » avec Sonia Combe. Il a récemment dirigé un numéro spécial de la Revue Germanique Internationale intitulé « Histoire et philosophie de la psychiatrie au XXe siècle : regards croisés franco-allemands».
Les épidémies et les virus font partie de notre imaginaire. Mais l’épidémiologie est une discipline méconnue du grand public, qui n’a pas d’idée claire sur le type de savoirs qu’elle produit, ni sur les indicateurs mis au point par les épidémiologistes.[1]
Depuis l’émergence de l’épidémie de COVID-19, l’épidémiologie s’invite dans notre vie quotidienne, sur les écrans, dans les journaux, et les données fournies par les épidémiologistes font tout d’un coup l’actualité. Pourtant, les leçons de l’épidémiologie, comme beaucoup de domaines scientifiques, ne sont pas intuitives. Les explications sont lacunaires ou pas assez explicites pour s’y retrouver facilement. D’abord, il n’y a pas une science des virus, mais un champ interdisciplinaire actif à plusieurs niveaux, fait de plusieurs types de savoirs qui se chevauchent et qui reçoivent les bénéfices de ce voisinage grâce aux échanges entre communautés scientifiques. Par exemple, depuis les débuts de la crise sanitaire causée par le COVID-19, la virologie, l’infectiologie, la biostatistique, la médecine tropicale ou encore la vaccinologie sont entrées en action, pas seulement l’épidémiologie. Le premier malentendu est de croire que l’épidémiologie est la science des épidémies virales. Non, aujourd’hui l’épidémiologie fournit essentiellement une modélisation des facteurs qui expliquent la diffusion d’un problème de santé dans la population. Voici une définition simple : « Un facteur de risque est tout attribut, caractéristique ou exposition d’un sujet qui augmente la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d’un traumatisme. »[2] Les cartes que les médias nous présentent sont basées sur des données épidémiologiques élémentaires, comme le nombre de nouveaux cas dans le temps et dans l’espace. Ensuite, sur la base de ces données, l’épidémiologie propose des indicateurs (fréquence, incidence, prévalence) pour prédire la diffusion d’une maladie dans la population, c’est-à-dire des probabilités en fonction de nos comportements et de l’environnement socioculturel dans lequel nous vivons. Il est bien évident, dans le cas de la pandémie due au virus COVID-19, que vivre dans un milieu urbain dense comme New York ou dans une zone rurale des Prairies canadiennes ne nous expose pas de la même manière.
L’expertise des épidémiologistes concerne donc la santé de la population dans son ensemble, pas seulement les malades. Contre toute évidence, je souhaite rappeler rapidement que l’épidémiologie contemporaine est un domaine de connaissance parfois contre-intuitif, qui a évolué ces dernières décennies sous la forme de modèles complexes, ce qui mérite quelques éclaircissements historiques. On trouve certes en librairie des livres sur l’histoire des grandes épidémies : peste, variole, choléra, typhus, tuberculose, syphilis, etc. Cette manière de penser la maladie a fait les riches heures de la géographie médicale, une discipline reine dans les facultés de médecine du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, dans la société qui a émergé après 1945, transformée par la production industrielle de nouvelles classes de médicaments comme les antibiotiques, ainsi que par le développement des politiques de santé internationales (création de l’OMS en 1948), les épidémiologistes ont ouvert leur champ d’expertise aux pathologies chroniques, sans plus se limiter aux maladies infectieuses, en procédant à des études comparées et interindividuelles. C’est ainsi qu’ils ont renouvelé leur cadre de pensée et développé des modèles basés sur les facteurs de risque. En effet, qu’une pathologie soit virale ou non, sa distribution dans la population est très inégalitaire et il est dès lors pertinent de s’interroger sur la stratification sociale et les « profils à risque » pour mener la prévention.
Il suffit de penser au lien désormais bien connu entre tabagisme et cancer du poumon. La preuve de ce lien est basée sur des corrélations. Évident ? Non, car il ne s’agit pas explicitement d’un lien causal mais d’une inférence[3] basée sur les statistiques, et parce que le lien n’a pas été démontré avant 1950. Fumer, dans cet exemple, c’est prendre un risque, au même titre que la pollution est un facteur de risque supplémentaire pour les affections pulmonaires de manière générale. Mais l’administration de la preuve est assez récente. En somme, l’épidémiologie a une histoire, la manière dont on comprend maintenant les facteurs de risque de l’épidémie de COVID-19 n’est plus celle avec laquelle on a compris la peste au Moyen Âge, le choléra au XIXe siècle ou encore le SIDA dans les années 1980.
En France, depuis la création de l’INSERM en 1964, l’épidémiologie est structurée sous la forme d’équipes de recherche. Citons les équipes pionnières de Joseph Lellouch (unité 169, épidémiologie des maladies chroniques), Daniel Schwartz (unité 21, biostastistiques), Philippe Lazar (épidémiologie environnementale ; puis unité 155, génétique épidémiologique). Mais ce n’est qu’il y a trois ans qu’un comité d’histoire de l’INSERM s’est constitué. Son premier Cahier[4], publié il y a seulement quelques mois, est justement consacré à l’histoire de l’épidémiologie. Autant dire que peu de personnes s’intéressent à ce type de publication spécialisée. Cependant, pensons à un type d’explication donné par les experts à propos du COVID-19, relayé par les journalistes et qui n’a pas percé au début de l’épidémie : il y a des individus infectés qui restent « asymptomatiques ». Qu’est-ce que cela signifie ? Ces individus sont porteurs du virus et ils sont susceptibles de contaminer leur entourage immédiat, mais ils ne ressentent pas de symptôme, ou bien seulement des formes atténuées qui ne sont pas alarmantes. D’où l’illusion d’impunité si on est bien portant. Ce phénomène est connu depuis longtemps et les manuels d’histoire de la médecine fournissent toujours le même exemple. C’est le cas de Mary Mallon – passée à la postérité sous le nom de Typhoid Mary – qui a propagé la fièvre typhoïde en travaillant en tant que cuisinière pour des familles aisées de New York au début du XXe siècle ; les familles furent décimées les unes après les autres à chaque engagement, ainsi que les employés de maison, mais Mary Mallon est restée en bonne santé et insoupçonnée d’être le réservoir des germes avant une étude épidémiologique. Un cas célèbre ? Oui. Connu de tous ? Non, force est de constater que seuls les historiens, certains professionnels de santé et les rares étudiants qui suivent des cours d’histoire de la médecine à l’université sont familiers avec ce cas d’étude. Pourtant les faits indiquent que l’épidémie n’a cessé que quand Mary Mallon a été placée en quarantaine.
Autre exemple, les épidémiologistes parlent de « vecteurs » et de « cluster ». Depuis quelques semaines, ces termes techniques se sont banalisés sur les sites d’information, alors qu’ils leur étaient encore inconnus au début de l’année 2020. Un vecteur peut être la surface d’un objet, où un virus est présent après un contact avec une personne infectée, et qui est susceptible d’intervenir dans la chaîne de transmission. Un cluster, toujours dans le cas d’un virus, prend la forme d’un cercle de sociabilité : l’épidémie de COVID-19 se répand au sein de la famille et au travail, chez nos proches, en fonction de nos habitudes sociales et de contacts plus ou moins rapprochés. Cela explique la décision d’interdire les réunions en groupe dans les espaces publics, même dans les parcs, une mesure mal comprise et guère appliquée à ses débuts, faute de pédagogie sur les risques, qui ne sont pas limités aux espaces confinés et qui peuvent s’accumuler. Car tous les membres d’un groupe n’encourent pas le même risque, il y a des phénomènes de comorbidité qui entraînent le risque supplémentaire de tomber plus gravement malade en raison d’autres problèmes de santé. Là encore, rien d’intuitif, puisque les affections pulmonaires ne sont pas les seuls facteurs de risque : par exemple, un surpoids important a été identifié comme facteur de risque en cas d’infection au COVID-19. Les facteurs sont multiples, ils s’additionnent ou interagissent : ils ne relèvent pas de notre observation immédiate, ni de nos intuitions, mais de l’analyse statistique.
Pour monter maintenant en généralité, le passage d’une étude des épidémies à une épidémiologie des facteurs de risque a ouvert la voie à une gestion des pathologies non-transmissibles, voire « maladies de civilisation »[5] Qu’entend-on par là ? Cela signifie que certaines maladies sont caractérisées par des « styles de vie à risque » et occasionnées, par exemple, par des excès en alimentation, en alcool, par le manque d’exercice, etc. On le voit, cette évolution des modèles épidémiologiques est liée à l’histoire des pays industrialisés. Cela signifie que l’épidémiologie n’est pas neutre, elle est intimement liée à nos modes de vie. Ainsi, ce que nous apprenons désormais sur les risques en situation de pandémie s’applique également à d’autres aspects de notre santé. Il existe une épidémiologie des maladies cardiovasculaires et des cancers[6] au même titre que l’épidémiologie de la grippe espagnole dont on nous rebat les oreilles à titre de leçon d’histoire, qui n’a pourtant rien d’exemplaire dans la mesure où le COVID-19 n’est pas la grippe. Certains problèmes de santé sont mieux connus que d’autres, voir surreprésentés au détriment d’autres. Par exemple, il existe une épidémiologie des troubles mentaux majeurs, comme la schizophrénie et la dépression, ou de troubles neuropsychiatriques plus spécifiques comme l’autisme, qui ne fait pas parler d’elle. En ce qui concerne cette dernière catégorie, il est intéressant de constater que les épidémiologistes ont également cherché des facteurs de risque, mais encore et surtout qu’ils ont été amené à démontrer l’absence de certains déterminants, contredisant en cela des théories dénuées de fondement. Qui sait par exemple qu’il existe des études[7] qui démentent l’existence de lien entre l’autisme et la vaccination des enfants ? L’épidémiologie a les outils pour affirmer si un lien est statistiquement significatif ou non, et donc pour éliminer les hypothèses douteuses, une ressource oubliée dans les débats.
J’aimerais terminer par un dernier exemple tiré justement de l’épidémiologie psychiatrique, pour montrer qu’on est encore loin d’une connaissance partagée des savoirs de l’épidémiologie et de ses enjeux historiques. Car faire l’histoire de l’épidémiologie n’offre pas seulement une meilleure compréhension de ce qu’est un facteur de risque aujourd’hui, mais aussi permet d’éclairer la construction sociale des catégories devenues centrales dans notre manière de concevoir la santé, comme le handicap, la résilience et la souffrance – même en matière de santé mentale. Et comme les opinions et avis d’experts divergent sur la manière de gérer la pandémie de COVID-19, les épidémiologistes tiennent aussi des positions divergentes sur les risques et les précautions à prendre pour prévenir les troubles mentaux parce que les statistiques sont sujettes à interprétation. Dans le cas du COVID-19, certains pays ont fait le choix de garder ouverts écoles et garderies, d’autres non, car la faible proportion d’enfants malades est interprétée différemment. Sur le même mode, comment interpréter les statistiques concernant le taux de rémission de la schizophrénie dans le monde, c’est-à-dire les facteurs susceptibles d’aggraver ou d’améliorer les symptômes de troubles mentaux psychotiques graves ? Sur la base des études de l’OMS, on distingue deux tendances : pour certains experts, le taux de rémission est interprété comme meilleur dans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés, tandis que d’autres affirment au contraire qu’il n’y a aucun indice statistique significatif. La société urbaine, industrielle et moderne, réputée anxiogène, augmenterait les risques de rechute, alors qu’une prise en charge des personnes souffrant de schizophrénie au sein de communautés plus traditionnelles favoriserait la rémission, une hypothèse diversement appréciée puisque les pays industriels ont aussi plus de moyens de soin. Cette controverse, notamment basée sur l’interprétation des données épidémiologiques, a opposé Norman Sartorius[8] (OMS) à Alex Cohen[9] (Harvard), ce dernier remettant en question l’axiome d’un meilleur taux de rémission des troubles mentaux majeurs dans les pays en voie de développement et le rôle de soins traditionnels promus par l’OMS pour une meilleure prise en charge de la schizophrénie au niveau communautaire, ravivant en même temps les enjeux de l’histoire coloniale et les accusations de néocolonialisme. En effet, les questions sont complexes : les pays industrialisés peuvent-ils dicter leur approche de la santé au reste du monde, au mépris des différences socioculturelles, dans des secteurs de la médecine où les données statistiques sont limitées et basées sur de vastes comparaisons internationales ? La controverse est intéressante car elle montre que l’épidémiologie est inséparable des enjeux sociaux, politiques et culturels, qu’il n’y a pas de statistique neutre, indépendante de nos modes de vie.
Cela est vrai à l’étranger comme en France, pour les maladies infectieuses comme pour les maladies chroniques. Finalement, si la situation actuelle génère une demande sociétale pour comprendre comment l’épidémiologie fait science et quelle est la signification des données épidémiologiques dont nous sommes bombardés en pleine crise sanitaire, il faudrait que les questions ne se limitent pas aux virus.
Notes
[1] Cet article est en partie tiré d’une présentation au Collegium-Institut d’Études Avancées de l’Université Lyon, le 28 janvier 2019. Remerciements : Erika Dyck, University of Saskatchewan.
[2] https://www.who.int/topics/risk_factors/fr/ [10 avril 2020].
[3] Giroux É., « Facteurs de risque et causalité en épidémiologie », Matière première, n° 1, 2010, p. 9-28.
[4] http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/10032 [10 avril 2020].
[5] Berlivet L., « Épidémiologie », in : Fassin, D. et Hauray, B. (éds.), Santé publique. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2010, p. 34-44.
[6] Jasen P., « Breast Cancer and the Langage of Risk 1750-1950 », Social History of Medicine, vol. 15, nº1, 2002, p. 17-43.
[7] Fombonne E., Zakarian E., Bennett A., Meng L. et McLean-Heywood D., « Pervasive Developmental Disorders in Montreal, Quebec, Canada : Prevalence and Links With Immunizations », Pediatrics, vol. 118, nº1, 2006, p. 139-150.
[8] Hopper K., Harrison G., Janca A., et Sartorius N. (éds.), Recovery from Schizophrenia. A report from the WHO Collaborative Project, The International Study of Schizophrenia, Oxford, Oxford University Press, 2007.
[9] Cohen A., Patel V., Thara R. et Gureje O., « Questioning an Axiom: Better Prognosis for Schizophrenia in the Developing World ? » Schizophrenia Bulletin, vol. 34, nº2, 2008, p. 229-244.
La Peste et le Corona
Article initialement publié sur le blog L'entrepôt à partir du 31 mars 2020.
Denis Thouard
Directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre Marc Bloch depuis 2008, Denis Thouard étudie la sociologie et la philosophie de Georg Simmel. Ses centres de recherche portant sur la question de l’interprétation, de la théorie herméneutique et de l’épistémologie des sciences sociales, il est également co-responsable du pôle scientifique « Pensées critiques au pluriel » du Centre Marc Bloch. Il a récemment publié Liberté et religion - Relire Benjamin Constant.
La diffusion rapide et mondiale de l’épidémie de corona-virus a contraint la plupart des pays à imposer des mesures plus ou moins drastiques de restriction des mobilités individuelles et de « confinement ». Les proportions rapidement mondiales de l’extension du phénomène ont étonné, notamment dans les pays les plus avancés, habitués à se sentir protégés de ce genre de cataclysmes. Les grands penseurs du moment se sont crus autoriser à commenter la situation, soit pour la réduire à une petite grippe dont s’empareraient les Gouvernements pour surenchérir dans l’illibéralisme, soit pour en tirer une lecture impliquant pourquoi pas le sort de la civilisation et l’avenir du capitalisme. Il y aura sans doute à faire le tri entre toutes ces « analyses » et « opinions ». Leur profusion est cependant un des aspects positifs de la crise actuelle, car elle témoigne que l’immobilité contrainte peut être mise à profit pour introduire un moment de réflexion dans nos vies. Plus celui-ci est partagé de ceux qui d’ordinaire ont trop peu de temps pour elle, plus la situation est prometteuse. C’est ainsi que – d’abord sans doute pour meubler un grand vide soudain installé au centre de l’espace médiatique – certains ont été déterrer de « bonnes lectures » en rapport avec notre situation, souvenirs de lectures anciennes, classiques un peu délaissés et tout d’un coup anoblis par une soudaine actualité (c’est d’ailleurs le propre des ‘classiques’: étant toujours en retard, ils ont de bonnes chances de nous précéder souvent…). Il y eut ainsi après l’attentat du Bataclan un regain d’intérêt pour le recueil de nouvelles d’Hemingway Paris est une Fête (à cause de son titre français, car le titre original n’évoquait nullement Paris !). Et voilà le tour de La Peste…
I
À vrai dire, l’affaire s’engageait mal. Nous étions enfermés, des camions passaient dans les rues munis de haut-parleurs et veillaient au respect du couvre-feu. Les radios redoublaient de pédagogie pour faire patienter les gens. On leur conseillait de revenir aux bons classiques, et particulièrement à cet Albert Camus laissé bien tranquille depuis les obligées lectures scolaires. Toutes les raisons pouvant alimenter la plus grande défiance étaient donc réunies.
C’est par défi que l’on s’y mit, par conséquent. Très vite, ce fut par gratitude. Il est des moments en effet pour lire certains livres. Peut-être suffisait-il simplement d’attendre.
Le gain est double : le roman déploie toute une logique des situations que le lecteur ne manque pas de reconnaître indirectement, puis de plus en plus directement. Oran touchée par la peste est mise en isolement, ce sujet apparemment bien exotique redevient soudain éclatant de justesse.
Il montre ainsi comment la diffusion de la menace révèle le socle de nos croyances ordinaires, incapables de prendre la mesure du danger ou même d’imaginer que celui-ci puisse nous toucher. Comment se sentirait-on concerné ? C’est un mal lointain, associé aux calamités du Moyen âge… L’épidémie montre que les croyances ont la peau dure. Mais elle montre aussi, inversement, combien nous sommes enclins à croire tout d’un coup en des remèdes miraculeux. Autrement dit, le premier ébranlement de nos assurances ordinaires est sans doute le plus décisif, car il nous fait percevoir tout ce que nous présupposons comme acquis et allant de soi. Tout cela, une fois violemment contesté, nous avons du mal à en faire le deuil, si somnolents que nous sommes. Cela, le roman le pose avec économie et force. « Nos concitoyens n’étaient pas plus coupables que d’autres, ils oubliaient d’être modestes, voilà tout, et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l’avenir, les déplacements et les discussions ? » (1248)
Puis l’exil. La quarantaine est un exil. Qu’est-ce à dire ? Là aussi, nous voilà coupés de nos certitudes et établissements familiers. Nos assises sont dans la mémoire concrète des êtres, des lieux et des objets. Or voici que, reclus, ils nous sont soustraits. L’être débranché a perdu une grande partie de sa force qui lui venait, sans qu’il y fasse réflexion, de son monde, des autres essentiellement.
Une fois qu’on eut dit « Fermez la ville », « à partir de ce moment il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l’inquiétude que leur avait apportées ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait poursuivi ses occupations, comme il avait pu, à sa place ordinaire. Et sans doute, cela devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s’aperçurent qu’ils étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac et qu’il fallait s’en arranger. » (1273)
Cet enfermement est physique, qui ne fait aucune exception. Il est aussi, non moins, psychique. Les gens perdent peurs habitudes : « la peste les laissait oisifs, réduits à tourner en rond dans leur ville morne et livrés, jour après jour, aux jeux décevants du souvenir. […] Ainsi, la première chose que la peste apporta à nos concitoyens fut l’exil. » (1276)
Le monde habituel nous est enlevé et il faut s’habituer à une sorte d’apesanteur affective, tel serait l’exil, auquel l’inconnue fondamentale de sa fin est essentielle. Le prisonnier peut savoir quand il sera libéré et noter les jours sur les murs de sa prison, l’exilé non.
Les repères se sont effacés, les gens se retrouvent « échoués à mi-distance de ces abîmes et de ces sommets, ils flottaient plutôt qu’ils ne vivaient, abandonnés à des jours sans direction et des souvenirs stériles, ombres errantes qui n’auraient pu prendre force qu’en acceptant de s’enraciner dans la terre de leur douleur ». (1277-78)
Ce que parvient à restituer Camus dans les premières parties de son livre est cette lente emprise du phénomène invisible ou peu visible, accompagné d’incrédulité et de superstition, deux attitudes plus voisines qu’on ne penserait. Contrairement aux craintes qui pouvaient faire hésiter le lecteur devant une telle œuvre, ce n’est pas un roman à thèse, malgré le propos évidemment politique.
L’usage de la contrainte dans les rues, le non-dit des disparitions, le sentiment absurde d’une saison qui arrive, l’été dans le roman, sans qu’elle puisse être accompagnée du mouvement vers les plages, cela parle aux contemporains contraints de considérer de loin la venue du printemps.
La distanciation introduite par le narrateur parlant de « nos concitoyens » est sans doute aussi une façon de faire reconsidérer le contenu du terme, de faire penser à ce qui peut relier profondément des citoyens entre eux, à s’interroger aussi bien sur ce qu’est, sur ce que peut un citoyen.
II
L’exil devient de plus en plus un enfermement. La menace se concrétise et la mort abstraite se monnaye en cadavres à enterrer. Une autre routine, mortuaire, s’installe. L’événement perd de sa singularité et on lui substitue la comptabilité des fiches. Les médecins et soignants doivent aussi se constituer, au-delà des masques de protection, une carapace morale. « Au grand élan farouche des premières semaines avait succédé un abattement qu’on aurait eu tort de prendre pour de la résignation, mais qui n’en était pas moins une sorte de consentement provisoire. Nos concitoyens s’étaient mis au pas, ils s’y étaient adaptés, comme on dit, parce qu’il n’y avait pas moyen de faire autrement. Ils avaient encore, naturellement, l’attitude du malheur et de la souffrance, mais ils n’en ressentaient plus la pointe. » (1366)
La formule est éloquente : « s’étaient mis au pas », tous seuls, sans qu’on les y force, car l’ennemi avec lequel on s’imagine parfois être « en guerre » n’est surtout qu’une menace. Celle-ci n’est telle que pour autant que l’on se sent menacé. Sans effets subjectif, pas de menace, tout juste une agression. La menace redouble donc celle-ci dans la conscience, et ses effets y sont délétères. La menace à laquelle l’on s’habitue en vient à transformer les comportements et constitue déjà une invite à l’ennemi auquel on fait toute la place. Mais cette forme de démission est cependant rémissible, pour Camus. L’habitude du désespoir serait au fond pire que le désespoir lui-même fait-il dire à Rieux. Sans doute cherche-t-il à introduire par-là la dimension du sursaut moral.
Ce consentement rend chacun spectateur un peu lointain de ce qui lui advient. Voici que « toute la ville ressemblait à une salle d’attente », ce qui est un brin fataliste. Voici que la dimension de l’exil, éprouvée dans la séparation d’avec les proches, les aimés, se trouve – par ceux-là même qui en sont touchés – considérée « sous le même angle que les statistiques de l’épidémie » (1367). « La peste avait supprimé les jugements de valeur. Et cela se voyait à la façon dont personne ne s’occupait plus de la qualité des vêtements ou des aliments qu’on achetait. On acceptait tout en bloc. » (1368)
La mise au pas de soi produite par la durée insoutenable de la menace débouche sur une hébétude généralisée. L’indifférence s’installe, l’insouciance se répand où la vigilance serait de mise. La fatigue morale s’empare de la ville au début de la quatrième partie du roman. La curiosité pour la situation réelle s’estompe, l’hébétude gagne, on ne s’informe plus de l’évolution du mal. « Et si on leur annonçait un résultat, ils faisaient mine de s’y intéresser, mais ils l’accueillaient en fait avec cette indifférence distraite qu’on imagine aux combattants des grandes guerres, épuisés de travaux […]. » (1374)
L’épuisement physique et la lassitude morale conduisent à ce que l’on néglige les règles mêmes que l’on avait édictées, les soignants ne se protégeant plus correctement eux-mêmes. On sait, on peut, mais on néglige, baisse la garde, renonce. Ce faisant, le risque est grand de ruiner tout ce que l’on a réussi jusque là à maintenir coûte que coûte en état de marche. Il y a un élément sournoisement suicidaire dans cette négligence.
On peut comprendre cette réaction anarchique et irrationnelle. Elle est une révolte contre la fatigue vaine, une impatience qui à sa façon restitue aux acteurs tenus à la stricte discipline une part d’orgueil et de colère, dont ils ont aussi besoin pour combattre. Mais c’est bien entendu une conduite de fuite.
Il faudrait réfléchir plus avant à la fatigue morale. Un ermite au désert, qui s’est infligé toutes les privations, après une vie exemplaire (au regard des attendus de sa foi), il se damnera absurdement pour un verre d’eau. Et pour donner un exemple moins allégorique, il n’est pas si rare que, dans une situation politique oppressive, les premiers et les plus radicaux des opposants, les plus irréductibles porteurs de l’idée de liberté, ceux qui ont pris tous les risques quand cela voulait dire quelque chose, le temps passant, par cette forme de lassitude morale peut-être, acceptent, la veille de la chute du régime honni, d’inaugurer un monument, de faire un discours, de participer à une commission. Les voilà aux enfers, remplacés par les résistants de la onzième heure, et l’on s’interroge, voulant apprécier leur mérite exact : pourquoi, à ce moment précis, une telle démission ?
Revenons au roman. Une scène sans doute peu remarquée me paraît significative et subtile. Un chapitre se clôt sur la crise de la représentation. La ville d’Oran représentait chaque semaine, dans son théâtre bien digne des sous-préfectures de la IIIe République, le spectacle qu’une troupe, emprisonnée dans la ville, ne devait jouer qu’une fois. Toute la bonne bourgeoisie continuait de s’y presser, formant « un parterre gonflé à craquer par les plus élégants de nos concitoyens ». On s’y montrait, on refaisait le spectacle de la société dans l’enceinte du théâtre. Bref, « l’habit chassait la peste » (1381).
La (bonne) société se donne en spectacle. Bien. Mais qu’est-elle censée voir ? Précisément Orphée et Eurydice. La ville se donne spectacle en masquant son sort funeste au moyen de cette représentation hebdomadaire. Peut-être même cherche-t-elle à exorciser son sort en rappelant qu’après tout les Enfers sont un lieu d’où l’on peut sortir ?
Or voici qu’Orphée meurt sous nos yeux. Il tue le spectacle en fracassant la mimesis. « C’est à peine si on remarqua qu’Orphée introduisait, dans son air du deuxième acte, des tremblements qui n’y figurent pas, et demandait avec un léger excès de pathétique, au maître des Enfers, de se laisser toucher par ses pleurs. Certains gestes saccadés qui lui échappèrent apparurent aux plus avisés comme un effet de stylisation qui ajoutait encore à l’interprétation du chanteur. » (1382)
Les spectateurs de la bonne société sont pris à défaut. Ils ne sont pas si avisés que cela. Ils se laissent aller au registre de la fiction, pressés de fuir un moment leur quotidien bouleversé. La tragédie peut bien être sur scène, ils sont là surtout pour la petite comédie de l’entracte.
Il fallut attendre donc le sommet esthétique de l’opéra, le duo d’Orphée et Eurydice, pour que l’édifice s’effondre. Le public commence à percevoir quelque chose. Le chanteur s’avance vers lui « d’une façon grotesque, bras et jambes écartés dans son costume à l’antique […] pour s’écrouler au milieu des bergeries du décor qui n’avaient jamais cessé d’être anachroniques mais qui, aux yeux des spectateurs, le devinrent pour la première fois, et de terrible façon. »
La salle se vide. Cottard et Tarrou restent seuls et contemplent les dégâts : « la peste sur la scène sous l’aspect d’un histrion désarticulé et dans la salle, tout un luxe devenu inutile sous la forme d’éventails oubliés et de dentelles traînant sur le rouge des fauteuils » (1382).
L’illusion de la normalité sauvée à tout prix s’estompe. Camus écrit avec rigueur et sérieux son grand poème de la Résistance. Il restitue parfaitement la faculté d'endormissement collectif qui saisit une population exposée à un danger durable. Il perçoit moins l’autre illusion qui saute aux yeux à l’image du théâtre d’Oran. Les « indigènes », comme il dit, sont remarquablement absents de tout le récit. Aussi absents que les citations mauresques sur la façade de l’opéra de la sous-préfecture...
La scène de l’opéra montre pourtant qu’une lecture à rebours en est possible, qui dénonce non seulement l’insouciance de la population bourgeoise en temps de peste, mais aussi bien son inconscience (volontaire) de la situation inique où elle se trouve (inconscience d’autant plus facile à vivre qu’une ville comme Oran est peuplée d’une population mélangée, majoritairement « européenne »).
III
« C’est un bon, c’est un excellent graphique », commenta le docteur Richard : le « graphique des progrès de la peste » montrait enfin un « long plateau » après avoir affolé les esprits « avec sa montée incessante ». « Désormais, elle ne pourrait que décroître. » (1412) On commençait de se rassurer et peut-être de se réjouir un peu « lorsque le docteur Richard fut enlevé par la peste, lui aussi, et précisément sur le palier de la maladie. » La chose avait été si rapide qu’il n’avait même pas fallu changer de paragraphe.
De fait, avant de nous proposer le retournement de la catastrophe, Camus, au quatrième acte de sa tragédie, en nourrit la péripétie. Dans le temps flottant de la diffusion épidémique, des arrêts, plateaux ou paliers, suivis de rechutes ou de rehausses, selon la perspective graphique adoptée, maintiennent la tension – on pourrait dire aussi bien : la fièvre. « Les formes pulmonaires de l’infection qui s’étaient déjà manifestées se multipliaient maintenant aux quatre coins de la ville, comme si le vent allumait et activait des incendies dans les poitrines. […] La contagiosité risquait maintenant d’être plus grande, avec cette nouvelle forme de l’épidémie. » (1413)
On ne sait plus trop quoi penser. La courbe se stabilise, mais le danger s’accroît. Le désarroi guette. « Au vrai, les avis des spécialistes avaient toujours été contradictoires sur ce point. » Voilà le problème d’une discussion ouverte, savante et informée… C’est que l’on a besoin de l’autorité des spécialistes, l’autorité est en quête d’autorité. Il faudrait choisir les « bons » spécialistes… C’est plus facile avec la presse. « Les journaux, naturellement, obéissaient à la consigne d’optimisme à tout prix qu’ils avaient reçue. » (1413) Mais le « sang-froid », si vanté, de la population, n’était apparemment pas tellement partagé. Les failles et les crevasses de la société confinée s’accusaient à la faveur.
Car en attendant la grande égalisation promise par la mort, la « spéculation s’en était mêlée et on offrait à des prix fabuleux des denrées de première nécessité qui manquaient sur le marché ordinaire. Les familles pauvres se trouvaient ainsi dans une situation très pénible, tandis que les familles riches ne manquaient à peu près de rien. » (1413) La nécessité montre son visage. Et derechef la peur.
Des « vêtements démodés » faits d’« étoffes caoutchoutées et brillantes » s’arrachaient soudain en raison de leur supposée vertu protectrice grâce à laquelle « chacun espérait une immunité » (1411). Quant aux acteurs principaux, médecins et soignants, ils n’ont aucune raison de céder trop tôt à l’optimisme imposé. Les signes et les courbes peuvent bien aller dans le bon sens : « Pour plus de sûreté cependant, le personnel sanitaire continuait de respirer sous des masques de gaze désinfectés. » (1413)
Le cloisonnement confine à l’enfermement, le confinement à la prison. C’est alors que Camus place une scène qui rouvre l’espace et permet d’envisager une échappée hors de l’ambiguïté indéfinie du renfermement. Rappelons-nous que nous sommes à Oran, ville dont il est dit pour commencer qu’elle est laide et que l’on s’y ennuie. (1219) On n’y perçoit même pas le défilé des saisons. C’est, est-il aussi écrit, une ville « sans soupçon », expression étrange qui est glosée aussitôt par « tout à fait moderne » (1220). Une ville quelconque, donc.
Mais pour un port de mer, elle a cette particularité un peu ingrate qu’on n’y voit pas la mer (un peu comme Barcelone avant qu’elle ne s’ouvre sur ses plages). L’auteur n’omet pas de le préciser, quand il nous présente cette « cité sans pittoresque, sans végétation et sans âme », sans doute enserrée dans un « paysage sans égal, au milieu d’un plateau nu, entouré de collines lumineuses », mais « construite en tournant le dos à cette baie », en sorte que « il soit impossible d’apercevoir la mer qu’il faut toujours aller chercher » (1221).
Alors que la ville commence à bouillir d’impatience et de fièvre, que les perspectives d’avenir demeurent ambiguës car les signes prognostiques sont contradictoires et que le discours officiel inspire une méfiance de plus en plus fondée, une scène vient soudain poser une tache de couleur dans cette grisaille. Vers la fin de la quatrième partie, Tarrou et Rieux ont soudain le pressant désir d’un bain de mer. Les voilà bientôt au port : « Derrière eux s’étageait la ville et il en venait un souffle chaud et malade qui les poussait vers la mer. Ils montrèrent leurs papiers à un garde qui les examina assez longuement. Ils passèrent et à travers les terre-pleins couverts de tonneaux, parmi les senteurs de vin et de poisson, ils prirent la direction de la jetée. Peu avant d’y arriver, l’odeur de l’iode et des algues leur annonça la mer. Puis ils l’entendirent. » (1428)
Ils utilisent les laissez-passer dont ils disposent en tant que personnels soignant, qui leur permettent de sortir un moment de la nasse. En même temps, il est clair qu’ils annoncent une percée hors du siège. Qui d’autre aurait pu la tenter ?
La mer, « souple et lisse comme une bête », dont les « eaux se gonflaient et redescendaient lentement » « en une respiration calme », est une puissance plus profonde que la peste.[1] En se plongeant en elle, les deux personnages se préparent à l’après de la peste, au recommencement. Ils nagent ainsi quelque temps en cadence, « solitaires, loin du monde, libérés enfin de la ville et de la peste » (1429). Une sorte de baptême.
La peste recule, les statistiques baissent enfin. Les signes deviennent enfin convergents et positifs. Pourtant, « il était difficile de décider s’il s’agissait d’une victoire » (1440). La maladie semblait plutôt partir comme elle était venue. Bientôt, c’est officiel. La liesse s’empare des rues. On se croirait soudain à la Libération. Le narrateur, qui se dévoile à la fin de l’histoire comme étant Rieux, rappelle pour finir que l’allégresse est « toujours menacée » (1474).
À ce moment-là, la peste n’est plus qu’un prétexte. La véritable question est celle du recommencement. Quelles possibilités de renouvellement réel ce bain de jouvence apporte-t-il ? S’est-on lavé déjà de l’expérience oppressante, négative, de l’enfermement ? Voici que les prix redescendent.
Qu’appelle-t-on « le retour à la vie normale » ? C’est la question de Cottard : « Il voulait savoir si l’on pouvait penser que la peste ne changerait rien dans la ville et que tout recommencerait comme auparavant, c’est-à-dire comme si rien ne s’était passé. » (1448) La discussion prend d’abord ces termes dans leur plus grande banalité. Mais peu à peu les interlocuteurs, ici Tarrou et Cottard, entrevoient qu’il faut aller plus loin : « tout le monde devra tout recommencer ». « D’une certaine manière, c’est une vie nouvelle qui va recommencer. » (1449) Vita nova.
IV
Non moins que l’envahissement sournois de l’épidémie qui suscite d’abord une incrédulité générale, le sujet du roman de Camus est la sortie de cet état d’auto-contrainte, de crise et de remise en question générale que matérialise l’enfermement. Est-ce que tout doit reprendre son cours « comme avant » ? Ou bien n’est-ce pas la possibilité de se reprendre et d’intervenir précisément sur le cours des choses et de l’organisation de la vie humaine qui se présente ici ? Ces questions sont au centre du roman paru en 1947.
Que faire de la Résistance et de la victoire ? Comment garder l’expérience d’un autre regard (moins égoïste ?) que les circonstances ont rendu possible, permettant à des aspects négligés en temps de paix, où chacun suit son quant-à-soi, de se déployer ? Ce sont les questions du journaliste de Combat, ce sont les inquiétudes du Résistant.[2] C’est qu’une fois la guerre passée, une fois le danger écarté, chacun n’a rien de plus pressé à faire que de l’oublier, de « repartir à zéro » (1449).
Qu’est-ce à dire ? ll y a bien deux façons de l’entendre. Ce peut être, en effet, faire table rase, oublier ce qui est advenu, et éventuellement faire comme si cela n’était pas advenu, retrouver donc ses habitudes, une fois le mauvais rêve dissipé. Un des moyens est d’ériger un monument officiel « aux morts de la peste » (1473). On se réunit, on fait des « discours » et … l’on va « casser la croûte ». Et voilà !
Mais ce peut être aussi « recommencer » au fort que suggère Camus, à savoir reprendre sur d’autres fondements et au plus près des principes essentiels qui se sont dévoilés pendant l’épreuve. C’est la raison d’être du roman qu’il expose à la toute fin, alors que son narrateur contemple depuis la terrasse qui surplombe la ville le commencement des festivités et les premiers feux d’artifice sur le port. En contemplant ces « gerbes multicolores », Rieux décide d’écrire « pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser au moins un souvenir de l’injustice et de la violence qui leur avaient été faites, et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser » (1473).
Le roman se donne comme un acte. Faire la chronique de ce qui a eu lieu, c’est d’abord témoigner, remémorer les actes et les situations. Depuis une telle récapitulation qui maintient la tension et la déchirure, une expérience collective traumatisante peut donner la possibilité d’un recommencement. On voit que Camus est déjà perplexe quant à la profondeur de celui-ci.[3]
La Peste nous parle-t-elle en nos temps de Corona ? Sans doute, mais pas forcément pour ce que le récit fait passer de l’épidémie, pas forcément pour la similitude des motifs ou les parallélisme manifestes. Le livre échappe à son objet pour avoir d’emblée été dans le décalage entre l’idée générale et la diversité des situations qu’elle pouvait évoquer. La rigueur de l’écriture et le maintien d’une certaine abstraction (qui a pour inconvénient sans doute que l’on ne parvient guère à s’attacher vraiment aux personnages) l’ont libéré de tout ancrage référentiel trop réaliste.
Conçu avant la Guerre (à laquelle Camus a pris sa part) dès 1938-39, le roman suit son cours autonome tout en réagissant et en commentant les événements qui ont lieu. Il reçoit en quelque sorte un contenu de l’expérience de l’Occupation et de la Résistance, tout en permettant de les commenter à distance. À la Libération, il permet de poser, grâce à son approche indirecte, les questions brulantes de l’après. En tant que chronique et témoignage, il se dresse en faux contre les tentations d’un oubli de ce qui a eu lieu, qui serait un double oubli : celui des valeurs morales de solidarité apparues au cours des années noires chez les résistants, mais non moins celui des crimes, qui comportent de l’impardonnable. La composition ouverte du projet rendait possible ce va et vient : « Il y a un plan que les circonstances d’une part, l’exécution d’autre part, modifient ». L’écriture s’efforce de mettre de l’ordre dans des fragments épars, travail d’autant plus pénible, confiait-il, « que mon anarchie profonde est démesurée » (1935).
C’est peut-être ce qui sauve le tout. Le désordre dans la composition rendait le projet ouvert à la contingence. Malgré le risque, ce n’est pas un roman à thèse. En même temps, la sobriété de l’écriture préserve sa lisibilité. Le texte est ainsi doté de sa propre puissance interprétative. S’il peut donner une lecture oblique des événements contemporains de son écriture, sans leur être ordonné ; il peut aussi interpréter ce qui n’a pas encore lieu et même ce qui paraît échapper à sa perception romanesque, comme la situation coloniale. On a vu que le journaliste Camus est au fait des enjeux essentiels (et aveuglé par ailleurs quant à bien des aspects) alors que le roman semble ignorer tranquillement ce contexte. Mais en l’ignorant si manifestement, rien ne dit qu’il ne permette pas de s’y affronter, ni que sa leçon de solidarité ne puisse être reçue de ceux qui n’apparaissent pas en lui et paraissent oubliés. Si le roman a gagné son pari d’universalité, il ne peut en aller autrement.
Nos contemporains sont-ils prêts à leur tour à se laisser interpréter par un tel roman ? Et dans ce cas, que leur dirait-il ?
Un gain immédiat est qu’il permet d’objectiver, en les anticipant, les réactions collectives : la peur, l’espoir, l’impatience, le découragement. Il dit particulièrement bien l’incrédulité d’une part, la solidité des habitudes, l’être dans le confort qui n’a plus la capacité d’imaginer que les choses pourraient en aller autrement. Il prévient d’autre part les recours farfelus de la crédulité. Il trouve les mots pour décrire la fréquentation quotidienne du drame et le malaise d’une catastrophe qui se traduit par des informations chiffrées, des graphiques à interpréter, et des cadavres qu’on va enterrer à la sauvette.
Il sait dire la séparation et l’exil qui résultent de l’enfermement. Sans doute cette dimension est-elle à même de nous parler plus fortement encore, nous qui nous sommes peu à peu habitués à considérer les déplacements comme une dimension essentielle de notre mode de vie. Le blocus de la ville donne ici à penser.
Mais c’est sans doute dans l’attention à la permanence de la peste après qu’elle a passé que le texte de Camus est porteur d’un « message ». La fin de l’épidémie ne peut signifier un retour à la « normale » si l’épidémie a pu avoir prise sur une société affaiblie, d’emblée prise de cette fatigue morale comme ces Français « fatigués d’avance en 1940 ».[4]
Et si l’effondrement des économies, la bravoure des soignants, la conscience retrouvés de « nos concitoyens », la révolte contre les hypocrisies des discours officiels, l’indignation contre leur teneur bonapartiste, la disposition soudain d’un temps d’abord vide et inquiétant, hors rythme, n’étaient pas l’occasion de… recommencer autrement ?
Notes
[1] Une variante donnée par Roger Quilliot dans l’édition Pléiade tirée du premier manuscrit terminé en janvier 1943 suggère une tentation nihiliste dans cette scène capitale : « Rieux s’arrêta le premier en songeant soudain à la profondeur qui se creusait sous ses pieds. Il en sentait l’attirance et l’oubli. Il lui semblait que sa longue fatigue trouverait enfin un repos dans le cœur d’eau et de sel d’une vie encore inexplorée. Stephan [nom d’un personnage alors envisagé, remplacé ici par Tarrou] revenait déjà vers lui et soufflait l’eau en avançant. ‚La mer est bonne‘, dit-il d’une voix essoufflée qui parut imperceptible au-dessus des eaux. ‚Oui, dit Rieux, on a presque envie de se laisser couler.‘ C’est vrai, mais ça empêcherait de recommencer. » (2001)
[2]Actuelles I donne en quelque sorte un commentaire par anticipation de La Peste. Voir A. Camus, Essais, édités par R. Quilliot, Paris, Gallimard, Pléiade, 1965 (cité Essais).
[3] Voir l’article de Combat paru le 10 mai 1947, intitulé « La contagion » dont il est opportun de citer quelques passages : « Il n’est pas douteux que la France soit un pays beaucoup moins raciste que tous ceux qu’il m’a été donné de voir. C’est pour cela qu’il est impossible d’accepter sans révolte les signes qui apparaissent, cà et là, de cette maladie stupide et criminelle. [suivent quelques exemples] Oui, ce sont là des signes. Mais il y a pire. On a utilisé en Algérie, il y a un an, les méthodes de la répression collective [il fait allusion aux massacres de Sétif de mai 1945]. Trois ans après avoir éprouvé les effets d’une politique de terreur, des Français enregistrent ces nouvelles avec l’indifférence des gens qui en ont trop vu. Pourtant, le fait est là, clair et hideux comme la vérité : nous faisons, dans ces cas-là, ce que nous avons reproché aux Allemands de faire. […] C’est pourquoi il est nécessaire de dire clairement que ces signes, spectaculaires ou non, de racisme révèlent ce qu’il y a de plus abject et de plus insensé dans le cœur des hommes. Et c’est seulement quand nous en aurons triomphé que nous garderons le droit difficile de dénoncer, partout où il se trouve, l’esprit de tyrannie et de violence. » (Essais, 321-323)
[4] Article de Combat, 29 octobre 1944, dans Essais (278).
Teil 1: Verstehen und Handeln angesichts der Corona-Krise: Was offenbart die Covid-19-Pandemie über die Herstellung gesundheits- und sozialpolitischer Solidaritäten in Europa (und anderswo)?
Erstveröffentlichung in französischer Sprache in La Vie des Idées, 3. Juli 2020. Aktualisierte und überarbeitete Version vom 27. Juli 2020
Olivier Giroud
Olivier Giraud ist Forschungsdirektor am CNRS. Von 2013 bis 2018 war er Co-Direktor des LISE (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique), Paris, nachdem er Forscher am Centre Marc Bloch (2006-2010) war, wo er u.a. die Arbeitsgruppe „Les échelles de l'action publique en Europe“ geleitet hat. Er ist Politikwissenschaftler und Soziologe und arbeitet im Bereich der vergleichenden Politikfeldanalyse, u.a. zur vergleichenden Analyse lokaler Pflegesysteme. Er war an Forschungsvorhaben zur Untersuchung der Beschäftigungs- und Ausbildungspolitik in mehreren europäischen Ländern beteiligt. 2019 hat er Les zones grises des relations de travail et d'emploi. Un dictionnaire sociologique (Teseo) mitherausgegeben.
Nikola Tietze
Die Soziologin Nikola Tietze ist Mitglied des Koordinationsteams des Forschungsschwerpunkts „Mobilität, Migration und räumliche Neuordnung“ am Centre Marc Bloch. Im Rahmen einer Kooperation mit der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur (WiKu) führt Nikola Tietze am CMB ihr Forschungsprojekt „Konflikte und Ordnungen – eine Verhältnisbestimmung im Kontext von Europäisierungsprozessen“ als Fellow durch, um den umkämpften Zugang zu sozialen Rechten im transnationalen europäischen Raum zu untersuchen. Zudem ist sie assoziierte Wissenschaftlerin am Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise, Cnam-Paris). Mit Monika Eigmüller hat sie 2019 Ungleichheitskonflikte in Europa: Jenseits von Klasse und Nation (Verlag für Sozialwissenschaften) veröffentlicht.
Camille Noûs
Camille Noûs verkörpert den Beitrag der akademischen Gemeinschaft als Ganzes zur Forschung. Diese Unterschrift, die die Gemeinschaft der Forscher*innen repräsentiert, betont den kollaborativen und offenen Charakter der Schaffung und Verbreitung von Wissen unter der Kontrolle der akademischen Gemeinschaft und soll zu einem Zeichen der Integrität werden. Die Bedeutung von “Noûs” verweist im Französischen (“nous” = “wir”) auf Kollegialität und stützt sich zugleich auf das Konzept des Verstandes oder des Intellekts der griechischen Philosophie (“νοũς”).
In den letzten Monaten, in denen Europa das Epizentrum der Covid-19-Pandemie gewesen ist, haben die Informationen über Infektions- und Todesfälle, über öffentliche Gesundheitsmaßnahmen, über soziale und wirtschaftliche Problemlagen unsere Bezüge und Maßstäbe in einen nationalen Rahmen eingeschlossen. Die kartographischen und statistischen Darstellungen der Ausbreitung des Virus und der sozialen sowie wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie folgten nationalstaatlichen Grenzen, nicht aber der Zirkulation des Covid-19. Gleichwohl ist die Pandemie zumindest ebenso eine globale und regionale Herausforderung wie eine nationale. Dies betonen mittlerweile auch die europäischen Regierungen und schließen sich in dieser Hinsicht den internationalen Organisationen wie etwa der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an: In einer dicht vernetzten Welt erfordern sowohl die Kontrolle des Covid-19 als auch die Bewältigung der sozialen Folgen der Pandemie zwischenstaatliche Koordination und Kenntnisse, die auf lokaler und internationaler Ebene produziert werden.
Die nationale Rahmung der Corona-Krise verbirgt zwei entscheidende Realitäten: zum einen die des globalisierten Wirtschafts- und Finanzaustauschs, der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität, des internationalen Tourismus, der Migrationen, der internationalen Interaktionen von Wissenschaftlern sowie nicht zuletzt die des multi-situierten transnationalen Lebensalltags vieler Personen und Familien, insbesondere in der Europäischen Union (EU). Das Covid-19 scheint eher auf den transnationalen Routen dichter kommerzieller oder auch religiöser Netzwerke und marktwirtschaftlicher, insbesondere arbeitsmarktbedingter Verflechtungen zu zirkulieren als gehorsam den staatlichen Grenzen zu folgen. Zum anderen überschattet die nationale Rahmung lokale Besonderheiten: örtliche transnationale Zusammenarbeit und Abhängigkeiten, sozioökonomische oder gemeinschaftliche Besonderheiten von Nachbarschaften, Solidaritäten im Kleinen, Unterschiede zwischen Berufsgruppen, kleinen und großen Unternehmen, Familienkonfigurationen usw. Wie sich gezeigt hat, hängt die Bewältigung der Pandemie stark von der Fähigkeit lokaler (kommunaler, vereinsgebundener, wirtschaftlicher etc.) Akteure ab, Informationen auszutauschen, Statistiken auszuwerten und Zahlen über Bedürfnisse und Risiken zu erstellen. Gerade in der Koordinierung von Gesundheitsmaßnahmen oder in der Organisation von Soforthilfe ist die lokale Handlungsfähigkeit essenziell gewesen.
Soziale Sicherheit und Gesundheitsschutz sind in Europa in unterschiedlichen Perspektiven konzipiert worden: als eine Antwort auf den Vormarsch des Marktes und auf die hierdurch systematisch verursachten Zerstörungen, als Stimulierungsinstrument wirtschaftlicher Nachfrage oder auch als Beitrag zu eher politischen Zielen, etwa zur nationalen Integration oder zur Bekämpfung von Ungleichheit. Seit nunmehr fast 40 Jahren jedoch ist der Markt angeblich, zumindest in den Augen derjenigen, die sich als seine Fürsprecher verstehen, nicht mehr mit den steigenden Ausgaben für soziale Sicherheit und Gesundheit vereinbar. Verteilt die Corona-Krise die Karten im Verhältnis zwischen Markt und sozialer Sicherheit bzw. Gesundheitsschutz neu? Gewinnen Gesundheits- und Sozialausgaben im gegenwärtigen Kontext die Tugend zurück, gleichzeitig die Bevölkerung zu schützen und die Wirtschaft am Leben zu halten? Oder sind Gesundheits- und Sozialschutz eine Bedrohung für den Markt, „schlimmer als das Virus selbst“? Nach welchen Maßstäben wird das Wissen produziert, das unsere Kenntnisse über die Widersprüche zwischen oder die Komplementaritäten von sozialer Sicherheit und Erhalt des Markts strukturieren? Verdeutlicht die Corona-Krise, dass zwischenstaatliche Koordination im Sinne von Multilateralismus ein Fehler ist? Oder gibt sie im Gegenteil Anlass, die infra-, inter- und transnationalen Koordinierungsformen, insbesondere auf europäischer Ebene, zu überdenken und in anderer Weise aufeinander zu beziehen?
Im Anschluss an diese Fragen nehmen wir im Folgenden die jeux d’échelles – die Fokus- und Maßstabsvariationen (Tietze 2019) – sowohl in der Wissensproduktion im gesundheits- und sozialpolitischen Bereich als auch in der action publique, die auf die Herstellung von Solidarität zielt, in den Blick.[1] Die Definition und Bearbeitung von sozialen und gesundheitsrelevanten Problemen, deren Übersetzung in Recht und Verwaltungsverfahren wie auch die Herausbildung von Instrumenten, mit denen die definierten Probleme auf der Basis von action publique bearbeitet werden, beruhen auf Interaktionen mit Marktakteuren. Die jeux d’échelles, die in Sozialstaaten zum Tragen kommen, sind also als Interaktionsräume zu verstehen. Sie werden einerseits durch die Handlungsfähigkeit der Akteure und durch deren finanziellen, beruflichen oder organisatorischen Ressourcen und Netzwerke und andererseits durch sowohl institutionelle (rechtliche, administrative, verfahrensbedingte etc.) als auch marktwirtschaftliche Zwänge und Möglichkeiten bestimmt. Unsere Untersuchung der Wissensproduktion und der Koordinierungsmechanismen im Hinblick auf soziale und gesundheitsrelevante Solidaritäten während der Corona-Krise zwischen Januar und Juni 2020 baut auf diesen multiskalaren Analyserahmen der jeux d’échelles auf.
Im Folgenden richten wir den Fokus in einer doppelten Perspektive auf die jeux d’échelles: Zunächst gehen wir von den national gerahmten Handlungsräumen aus und unterscheiden verschiedene Modelle, mit denen subnationale – regionale oder lokale – Interaktionen und mit ihnen verbundene Maßstäbe aufeinander bezogen werden. In verschiedenen Staaten und auf verschiedenen territorialen Ebenen ist die Beziehung der action publique zum Markt und im weiteren Sinne zum privaten Sektor zu einer strukturierenden Variablen in der Herstellung von Solidaritäten geworden, was die Beziehungen zwischen den territorialen Ebenen sozialpolitischer und gesundheitsrelevanter action publique tiefgreifend verändert hat. In einem zweiten Schritt konzentrieren wir uns auf die Untersuchung der trans- und internationalen Wissensproduktion und -koordination, die mit der Definition und Bearbeitung von Gesundheitsfragen und sozialen Problemen befasst ist. Hierbei stellen die Herausbildung von Standards und rechtlichen Normen, die Etablierung und Nutzung von Koordinierungsmechanismen, die Interdependenzen zwischen den einzelnen Akteuren wie auch zwischen Akteuren und marktwirtschaftlichen Logiken die Schlüsselelemente unserer Untersuchung dar.
Covid-19 als Stresstest der Gesundheits- und Sozialsysteme?
Angesichts des Notstands, den die Covid-19-Pandemie hervorgerufen hat, war die Fähigkeit, das auf der internationalen Ebene produzierte Wissen mit lokalen Kenntnissen und Erfahrungen zu verknüpfen, für die action publique von ausschlaggebender Bedeutung. Dies zeigt nicht zuletzt ein vergleichender Blick auf die Situationen in Deutschland und Frankreich in den ersten Monaten 2020. In Deutschland ist die Zahl der durch das Covid-19 verursachten Todesfälle relativ gering geblieben und die Zirkulation des Virus konnte vergleichsweise schnell eingehegt werden. Die deutschen Gesundheitsbehörden und Wirtschaftsakteure haben ab Januar 2020 die Informationen, die chinesische Forscher bekannt gaben, sowie die Warnungen von Virologen und die Ratschläge der WHO ernst genommen. Vertreter der Länder und des Bundes erkannten relativ früh die Notwendigkeit, Patienten systematisch zu testen, zu isolieren, ihre Kontaktpersonen unter Quarantäne zu stellen und „Cluster“ zu identifizieren (Fertikh 23.04.2020). Lokale kleine und mittlere High-Tech-Unternehmen haben bereits im Januar mit der Massenproduktion von Tests begonnen (RogueESR und das wissenschaftspolitische Seminar 26.04.2020). Statt auf strikte Ausgangsbeschränkungen setzte man auf das individuelle Verantwortungsbewusstsein, schloss öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungsorte und erließ lediglich eine Kontaktsperre.
In Frankreich erreichen die durch Covid-19 verursachten Todesfälle wesentlich höhere Zahlen. Das ganze Land ist für zwei Monate einem strengen und autoritären confinement (Ausgangsbeschränkung) unterworfen worden. Bis Mitte März leugneten der französische Staatspräsident und die Regierung in der Öffentlichkeit die Risiken der Pandemie. Obwohl die WHO bereits seit mehreren Wochen Alarm schlug und die Lage im benachbarten Italien seit mehreren Wochen immer ernster wurde, hielten die französischen Regierungsvertreter an ihrer Agenda sozial-, wissenschafts- und bildungspolitischer Reformen fest (RogueESR und das wissenschaftspolitische Seminar 26.04.2020). Der institutionalisierte Rückbau des öffentlichen Gesundheitssystems hatte zudem die Chancen untergraben, der Funktion der Gesundheitsüberwachung gerecht zu werden. Seit Dezember 2019 verbanden sich die Kritik und die gesellschaftliche Mobilisierung gegen die Reform der Arbeitslosenversicherung und gegen die geplante Rentenreform mit der schon seit mehreren Monaten andauernden Protestbewegung des Krankenhauspersonals, das den Mangel an Mitteln und Personal sowie die Kommodifizierung der Gesundheit anprangerte, und schließlich ebenfalls mit dem Protest der Wissenschaftler, die angesichts der angekündigten Reformen im Rahmen eines neuen Forschungsrahmengesetzes die zunehmende Prekarisierung in der Forschung und Lehre kritisieren (Eloire et al. 2020). Darüber hinaus hat die schwächere und stark durch Lean-Management charakterisierte französische Industriestruktur die Möglichkeiten verringert, schnell auf den Mangel medizinischer Ausrüstung zu reagieren. Eine schwerfällige und inkohärente Verwaltung des öffentlichen Gesundheitswesens verzögerte einerseits die Bestellung notwendiger medizinischer Ausrüstung und Geräte und andererseits die Erteilung von Genehmigungen für die Herstellung von Tests und anderem Material.
Die territorialen Organisationsformen von Gesundheits- und Sozialpolitiken auf dem Prüfstein
Welche politischen Logiken erklären solche Unterschiede wie diejenigen zwischen Deutschland und Frankreich? Historisch gesehen haben die wohlfahrtsstaatlichen Systeme zur Stärkung der Nationalstaaten beigetragen (Clarke 2005). Allerdings verändert sich heute die Organisation nationaler Solidaritäten, insbesondere in Ländern mit regionalistischen Bewegungen und entsprechenden Gemeinschaften – Schottland, Quebec, Katalonien (Béland, Lecours 2004) – oder auch in Ländern, in denen der sozialstaatliche Ausgleich von Wohlstandsunterschieden zwischen den Regionen angefochten wird, wie etwa in Italien oder Spanien (Keating 2009).
Im Hinblick auf diese Veränderungen sind drei Faktoren hervorzuheben. Erstens erzwingen verfassungsrechtliche Vorgaben (z.B. Föderalismus versus Einheitsstaat) rechtliche Normen für den Solidaritätsausgleich interregionaler Disparitäten. Zweitens tragen die nationalen Systeme sozialer Sicherheit dazu bei, den Ausgleich sozialer und territorialer Ungleichheiten zu stabilisieren. Im Allgemeinen werden die Risiken der Arbeitslosigkeit, des Alters und der Krankheit in einem zusammenhängenden nationalen Rahmen kompensiert, der nicht nur eine stärkere Umverteilung zugunsten der ärmsten Gebiete, sondern auch mehr Schutz für alle bietet. Drittens beeinflussen soziale Bewegungen, die mehr oder weniger ausgebildete Integrationsfähigkeit von Netzwerken oder politischen Kulturen die integrative, gewissermaßen „nationalisierende“ Kapazität einer territorialen Architektur, mit der Solidaritäten in einem nationalstaatlichen Rahmen realisiert werden.
Auf lokaler Ebene führen ebenfalls vielfältige Dynamiken zu Veränderungen. Häufig wird in der Gesundheits- und Sozialpolitik die lokale Ebene mit der Vielfalt verfügbarer Dienste und Maßnahmen in Verbindung gebracht, was der Einheitlichkeit der nationalen Versorgung zuwiderlaufen kann (Evers 1990). In manchen Fällen werden lokale Arrangements des öffentlichen Diensts favorisiert und durch Tätigkeiten im Vereinssektor ergänzt. In der Lombardei zum Beispiel findet man eine solche Situation in vielen Kommunen, deren Regierungen Mitte links zu verorten sind und die versuchen, die rechtskonservative bis rechtsextremistische und liberale Politik der Regionalregierung im Gesundheits- und Sozialbereich auszugleichen. In anderen Fällen wiederum steht die lokale Ebene für eine Vermarktlichung, die die Universalität wohlfahrtsstaatlicher Dienstleistungen aufhebt und ein segmentiertes und am Einkommensniveau der Menschen orientiertes Leistungsangebot etabliert. So hat beispielsweise die Stadt Edinburgh das von der in Schottland regierenden Scottish National Party eingeführte universalistische System der häuslichen Altenpflege vollständig untergraben, indem sie fast alle sozialen Dienste der Stadt privatisiert hat (Giraud et al. 2014).
| Die Zentrum-Peripherie-Profile der Sozialschutzsysteme |
Zu Beginn der 2000er Jahre koordinierte der italienische Politikwissenschaftler Yuri Kazepov ein breit angelegtes Forschungsprojekt über das Rescaling in der Sozialpolitik (Kazepov, 2010). Auf der Grundlage der von G. Esping-Andersen (1990) herausgearbeiteten Sozialstaatstypen und auf der Basis statistischer Daten und einer Analyse von verschiedenen europäischen Sozialstaatsinstitutionen arbeitete er unterschiedliche Zentrum-Peripherie-Konfigurationen der action publique im sozialpolitischen Bereich heraus. Der liberale Typus des Sozialstaates, der hauptsächlich durch Steuern finanziert wird und dessen minimalistische Interventionen dem Markt und der Familie untergeordnet sind, geht nach Kazepov aus einer „zentralisierten Regierungsführung“ hervor. Mit dieser Kategorisierung, die Kazepov am Beispiel der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs entwickelt, geraten gleichwohl die öffentlichen Dienstleistungen im sozialen Bereich auf der regionalen Ebene aus dem Blick. Dies trifft insbesondere auf die Gesundheitsversorgung in den Vereinigten Staaten zu (Gray et al. 2009). Der sozialdemokratische Typus, der als umverteilungsfähigster und als weitgehend universell angelegter Sozialstaat gilt, wird hauptsächlich durch Steuern finanziert. Kazepov bezeichnet ihn als ein Regime der „lokalen Autonomie mit zentralisierter Regierungsführung". In den skandinavischen Ländern, die hier als Beispiele dienen, werden viele Dienstleistungen und Sozialleistungen kommunalisiert, was mit der Privatisierung der Dienstleistungsanbieter einhergehen kann. Die allgemeinen Orientierungslinien dieser kommunalisierten sozialpolitischen action publique werden jedoch auf der nationalen Ebene bestimmt. Das korporatistische Regime, das traditionell über die Sozialversicherungsabgaben finanziert wird und wenig wirksam in Bezug auf Umverteilung ist, beruht auf unterschiedlichen, ja gegensätzlichen territorialen Organisationsformen. Die Regierungsführung kann zentralisiert sein, wie in Frankreich, oder föderal, z. B. wie in den deutschen Bundesländern und vor allem der Schweiz. Das verfassungsrechtliche Gebot zum Ausgleich der Lebensbedingungen in Deutschland und die institutionelle Isomorphie im schweizerischen Fall führen jedoch zu einer starken Homogenität im Gesundheits- und Sozialbereich beider Staaten. Dennoch ist die regionale Autonomie real. In Frankreich korrigieren die auf der Departement-Ebene etablierten Kompetenzen im sozialpolitischen Bereich teilweise die Zentralisierung der action publique (Lafore 2004). Dasselbe gilt für die kommunale Autonomie in spezifischen Politikbereichen – Kleinkind-Versorgung, Alter, Armut, Sozialarbeit usw. (ibid.). Hier werden nationale Politiken ergänzt oder auch Alternativen zu ihnen entwickelt, zu denken ist etwa an die Tradition des kommunalen Sozialismus oder an die in der katholischen Kultur verankerte Fürsorge. Das „familialistische“ Regime, das ebenso meritokratisch wie, wenn auch weniger ausgefeilt als der korporatistische Sozialstaatstypus ist, stützt sich in einer ganzen Reihe von soziapolitischen Aspekten auf Familiensolidarität. Nach einer Phase der Zentralisierung in den 1970er Jahren sind die familienorientierten Länder, darunter Spanien und Italien, zu „Regionalregierungsregimen" geworden. Allerdings gleichen sie kaum die in diesen Ländern starken Ungleichheiten zwischen den ärmsten und den reichsten Regionen aus. Insgesamt kommt Kazepov in der von ihm koordinierten und vergleichenden Studie zum Schluss, dass es in den Sozialstaatssystemen zu einer doppelten Subsidiarisierung gekommen ist: zum einen in vertikaler Hinsicht zugunsten dezentraler, ja lokaler Akteure und zum anderen in horizontaler Hinsicht zugunsten privater Akteure. |
Welche politische Bedeutung haben die territorialen Logiken des öffentlichen Handelns angesichts von Covid-19?
In der Covid-19-Krise haben die verschiedenen öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen – Ausgangs- oder Kontaktsperren, Lockdown, confinement etc. – eine zum Teil radikale Neuordnung der territorialen Architektur der Solidaritätsorganisation erzwungen. In Frankreich war der Aktionsradius der Menschen monatelang auf einen, dann auf hundert Kilometer, in Italien zeitweise und an bestimmten Orten auf 200 Meter begrenzt. Ausschließlich „zwingende familiäre Gründe“ erlaubten in Frankreich gemäß der ab Mitte März geltenden Regeln das Ausüben von Solidarität. Wie können unter diesen Bedingungen familiäre, lokale, regionale, berufliche oder auch nationale Solidaritäten zueinander in Beziehung gesetzt werden? An die Stelle beruhigender, seit Jahrzehnten gewachsener Konfigurationen territorialer Ordnungen und der mit jenen verbundenen sozialen Rechte sind die gesundheits- und sozialpolitischen Diskurse in der Corona-Pandemie getreten, die durch Brüche, Diskontinuitäten und Spannungen charakterisiert sind. Bewegungsverbote verhindern, dass man Ansprüche auf soziale Leistungen und soziale Rechte geltend machen kann. In ihren Wohnungen isoliert, sind die Menschen gezwungen, ihre Sozialbeziehungen auf die Kernfamilie, die Wohngemeinschaft oder das Wohnheim (für pflegebedürftige alte Personen, für Asylsuchende, Studierende etc.) zu reduzieren. Wenn die wesentlichen familiären oder freundschaftlichen Bindungen sich über große geographische Distanzen hinweg ziehen, ist ein solidarisches Agieren ausgeschlossen.
Die extreme Reduzierung des individuellen Bewegungsradius steht in einem Kontrast zu der politischen Fokalisierung auf den nationalen Raum. Im März 2020 und für einen mehr oder weniger langen Zeitraum transformierten sich mehrere europäische Staaten in zentralisierte und abgeschlossene Gesundheitsrepubliken, in denen die nationalen Regierungen zunächst die gesamte Entscheidungsmacht an sich rissen. Ist diese Reaktion im Fall der am stärksten zentralisierten Länder wie Frankreich keineswegs überraschend, so ist sie ungewöhnlich beispielsweise für die Schweiz, ein stark dezentralisiertes Land, in dem der Bundesstaat gerade im Gesundheitsbereich keine bedeutende Kompetenz besitzt. Im März 2020 kehrte Bern zu seiner Rolle als hierarchische Hauptstadt zurück und ordnete gemäß Artikel 7 der Bundesverfassung die „außerordentliche Situation“ an, dass alle Kantone einheitliche nationale Gesundheitsvorschriften einhalten müssen. Gleichzeitig wurde die Außengrenze des Landes hermetisch abgeriegelt, außer für „Grenzgänger“, die als Arbeitnehmer für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems unerlässlich waren. Die Ausbreitung des Virus, die im italienischsprachigen Teil des Tessins viel höher war als im deutschsprachigen Teil des Landes, erforderte nach Ansicht der Regierung dieses Kantons dennoch spezifische Maßnahmen zur Eindämmung und Verlangsamung des gesellschaftlichen Lebens. Doch setzte der Bundesrat die föderalen sanitären Vorschriften gegen diejenigen durch, die die Tessiner Regierung nach italienischem Vorbild einführen wollte. Die intensive Zirkulation des Virus in der italienischen Schweiz weist im Übrigen auf die starke Integration dieses Kantons mit der Lombardei, der am stärksten betroffenen italienischen Region, hin. Jenseits der Effektivität der schweizerischen Präventionspolitik zeigte wiederum in den folgenden Wochen die verhältnismäßig geringe Verbreitung des Covid-19 in der übrigen Schweiz, wie wenig das italienischsprachige Tessin südlich der Alpen mit den deutsch- und französischsprachigen Metropolen der Schweiz integriert ist.
Nach Wochen nationaler Disziplinierung ist heute in den verschiedenen europäischen Ländern das Bewusstsein für Kapazitäten und Defizite der zentralisierten Gesundheitsregime gewachsen. Lokale Mobilisierungen, Netzwerke und lokales sowie regionales Wissen sind zurückgekehrt. So kündigte die deutsche Bundeskanzlerin zum Beispiel am 5. Mai an, dass sie den Großteil der Regeln für den Rückbau der Kontaktsperre den Landesregierungen anvertrauen werde. Spanien, Russland, die Schweiz und die Vereinigten Staaten sind ähnlichen Strategien gefolgt. Lediglich in Frankreich und Großbritannien wird weiterhin auf das Modell zentralisierter Gesundheitsregime gesetzt. Jenseits dieses Gegensatzes expliziter Strategien werden die Spannungen zwischen Zentrum und Peripherie in der Corona-Krise gleichwohl auf komplexe Weise neu geordnet, u. a. mithilfe einer Neujustierung des Zusammenspiels territorialer und institutioneller Ebenen. Hierbei zeichnen sich drei wesentliche Dynamiken ab: die der vorstrukturierten Zentralisierung, die der harmonisierten Dezentralisierung und die der konfliktgeladenen Dezentralisierung.
1) Eine Dynamik vorstrukturierter Zentralisierung ist in Frankreich und Großbritannien zu beobachten. In beiden Ländern legen die öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen während der Corona-Pandemie den künstlichen Charakter der Dezentralisierung des Gesundheitssystems vollständig offen. Die französischen regionalen Gesundheitsagenturen (Agences régionales de santé, ARS) sind Institutionen, die aus einem unklaren Kompromiss zwischen den Verteidigern des Zentralismus und den Befürwortern der Dezentralisierung hervorgegangen sind. Letztendlich sind sie der Ausdruck dafür, dass die Zentralismus-Verteidiger unfähig sind, die ihnen in ihren Augen zustehenden hoheitlichen Funktionen aufzugeben und Verantwortung an dezentralisierte Akteure abzugeben (Rolland, Pierru 2013). Im Rahmen eines Systems eingeschränkter Verwaltungsautonomie mussten die ARS drastische Haushaltskürzungen im Gesundheitssektor und insbesondere im öffentlichen Krankenhauswesen vor Ort bewältigen und verwalten. In bestimmten regionalen Kontexten ermöglichte ein positives Verhältnis zwischen den ARS-Verantwortlichen und den Abgeordneten der conseils régionaux und nunmehr zunehmend den gewählten Vertretern der conseils départementaux, Synergien für die Entwicklung harmonisierender Regelungen zu entwickeln, was letztlich zu einer Stärkung der territorialen Autonomie führte. Solche positiven Konfigurationen sind gleichwohl die Ausnahme. Die britische Situation ist in ihren Grundzügen nicht anders. Doch ist der Druck durch Budgetkürzungen, insbesondere in Krankenhäusern, in Großbritannien noch stärker als in Frankreich. Die Autonomie der regionalen Agenturen des britischen National Health Service, der NHS Trusts, ist mindestens so fiktiv wie die der französischen ARS.
In der Corona-Krise zeigten sich das britische und französische zentralisierte Regime in verschiedener Hinsicht als unfähig. Die zahlreichen organisatorischen Redundanzen in Frankreich sowohl im Zentrum des öffentlichen Gesundheitssystems (Santé publique France, Direction générale de la santé [Schlüsselinstanz des nationalen Gesundheitsministeriums], Agence nationale de sécurité sanitaire, Haute autorité de santé usw.) als auch im Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie haben verdeutlicht, wie sehr ein institutioneller Maquis die Entscheidungsfindung und deren Umsetzung lähmt. Immer wieder und in allen höchst dringlichen Angelegenheiten trafen Expertisen, Genehmigungen, Material, Rückmeldungen über Erfahrungen, Daten usw. zu spät ein. Fehler, Irrtümer und Verzögerungen untergruben zunächst die Glaubwürdigkeit und machten dann die Mächtigen der französischen Gesundheitsrepublik lächerlich. Näher betrachtet verweist der institutionelle Maquis, der sich im Kontext verstärkter Kontrolle und Kürzung staatlicher Ausgaben herausgebildet hat, allerdings darauf, dass berufliche, fachspezifische, institutionelle und andere Interessen ganze Bereiche des öffentlichen Gesundheitswesens beherrschen. Zudem steht er im Zusammenhang mit der Unfähigkeit des Staates, sich zwischen diesen Partikularinteressen zu entscheiden. Ebenfalls hat die Tatsache, dass den Finanzabteilungen die Entscheidungsmacht im Gesundheitswesen überlassen worden ist, nicht geholfen, die Konflikte zwischen Berufsgruppen zu überwinden. Schließlich erklären die Defizite in der Gesundheitsüberwachung die Verzögerungen und die mangelnde Vorbereitung des französischen Gesundheitssystems in den ersten Monaten 2020. Sie gehen nicht zuletzt auf die geringe Anerkennung zurück, die Expertise bzw. Wissenschaft bei den politischen Entscheidungsträgern in Frankreich genießt. Der französischen Zentralregierung ist es allenfalls mithilfe der spektakulären TGV-Krankenhäuser (Krankenhäuser in den französischen Hochgeschwindigkeitszügen)gelungen, eine Schlüsselfunktion der zentralisierten Gesundheitsrepublik für die nationale Solidarität im Gesundheitswesen zu inszenieren: die Fähigkeit, Patienten auf dem gesamten Staatsgebiet rationell zu verteilen.
Will man herausfinden, was in Frankreich auf der Ebene von Gesundheits- und Sozialpolitik tatsächlich geschieht, ist es notwendig, die regionale Presse zu lesen oder die zahlreichen präzisen und aktuellen Bulletins der Uniopss (Dachorganisation der Verbände im Gesundheits- und Sozialbereich, die sich auf ein in den Regionen stark organisiertes und mitgliedernahes Netzwerk stützt) zu verfolgen. Mit Erleichterung kann man hier feststellen, dass die französische Höllenmaschine des öffentlichen Gesundheitssystems glücklicherweise nicht alles das, was sie organisieren und verwalten soll, blockiert.
2) Staaten, die auf eine harmonisierte Dezentralisierung aufbauen, haben nach der zentralisierenden Episode, die die Krise praktisch überall hervorgerufen hat, schnell zu ihrer gewohnheitsmäßigen Organisation zurückgefunden. Auf Deutschland, wo Anfang Mai 2020 die Aufgabe, die Aufhebung der Kontaktsperre zu organisieren, den Ländern übertragen worden ist, haben wir oben hingewiesen. Die Schweiz organisierte ebenfalls entsprechend der erreichten Verbesserungen der Gesundheitssituation Lockerungen bezüglich des zentralisierten Charakters der Vorschriften. Zwar werden die Daten und Etappen der Lockerung von der Berner Regierung festgelegt und vom Bundesamt für Gesundheit übermittelt, doch gewinnen die Kantone nach und nach ihre Autonomie in der konkreten Organisation zurück: Wiedereröffnung der Schulen, der öffentlichen Verkehrsmittel, der Geschäfte usw. Die Kantone sind nun für die jeweilige Umsetzung dieser Wiederöffnungen zuständig. Anders als in Deutschland definiert das Zentrum also in der Schweiz nach wie vor in überraschend direktiver Weise die Grundregeln, aber die Autonomie und Verantwortung der Kantone, der Gemeinden und vor allem der Individuen wird in den offiziellen Reden und in den Maßnahmen, die die Grundlage öffentlicher Steuerung bilden, auch in der Krisenzeit aufgewertet.
Auf einer eher horizontalen Ebene wird die Situation der deutschen privaten Krankenhäuser, die nach Ansicht einiger Kommentatoren in Frankreich der Schlüssel für ein gutes Management des öffentlichen Gesundheitssystems jenseits des Rheins ist, oft falsch interpretiert. Seit dem Kaiserreich verwalten die Wohlfahrtsverbände der Kirchen und der Arbeiterbewegung den größten Teil des Gesundheits- und Sozialsystems und stehen hierbei mit den staatlichen Behörden in enger Verbindung. Es handelt sich also in weiten Teilen um ein para-öffentliches System und nicht um ein ausschließlich privates und kommerzialisiertes System. In dieser Hinsicht sind die Reaktionsfähigkeit und Flexibilität des deutschen Gesundheitswesens eher auf den Pluralismus und die dezentralisierte Regulierung zurückzuführen, die sich gegenüber der zögerlichen Dezentralisierung in Frankreich bewährt hat.
Insgesamt gesehen zeichnet die Länder mit harmonisierter Dezentralisierung vor allem der nationale Konsens über die Gesamtstrategie in der Bewältigung der Gesundheitskrise und in der Kompetenzverteilung aus. Mögliche institutionelle Konkurrenzen werden auf dieser Basis nicht verschärft. Die politische Kultur des Kompromisses und das Fehlen einer übermäßigen Polarisierung bei der Produktion und Bewertung wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglichen eine wirksame Koordination in den jeux d’échelles, die die öffentliche Herstellung von Solidaritäten strukturieren.
3) Ganz anders stellt sich die Situation im Fall der dritten Konfiguration dar. In Systemen, die auf einer konfliktgeladenen Dezentralisierung aufbauen, werden die Entscheidungen in der Corona-Krise nicht koordiniert. In den komplexesten Fällen führen sie zu Konflikten; in weniger schwierigen Fällen werden Entscheidungen nicht geteilt. In den USA zum Beispiel wurde ein in den Institutionen verwurzelter und durch extreme politische Polarisierung verschärfter Konkurrenzkampf um staatliche Legitimität, Handlungsfähigkeit und Staatswissen deutlich. In Anlehnung an den israelischen Politikwissenschaftler Daniel Elazar (1997) steht die US-amerikanische Konfiguration für eine Matrix, die die Machtverhältnisse zwischen der Bundesebene und den Staaten nicht hierarchisiert. Dies gilt in besonderem Maße für das Gesundheitswesen, in dem das federal government letztendlich kaum tätig wird. Die Zentralregierung gibt das Ziel der zivilen Sicherheit und das des wirtschaftlichen Wiederaufschwungs vor und überlässt es den Bundesstaaten, sich konkret mit der Pandemie auseinanderzusetzen. Die Krise, die in der US-amerikanischen Demokratie die fortschreitende Zerstörung des Konsenses über minimale Basiswerte und -prioritäten verursacht, verwandelt die institutionell regulierten Konkurrenzen in gewaltprovozierende Spannungen. Dies wurde nicht zuletzt deutlich, als bewaffnete Demonstranten das Parlamentsgebäude eines Bundesstaats stürmten, um, wie der Präsident der Vereinigten Staaten aufgerufen hatte, das Ende des von der demokratisch gewählten Bundesstaatsregierung beschlossenen Lockdowns zu fordern. Die Missachtung, mit der das US-amerikanische Machtzentrum den demokratischen Normen und Traditionen begegnet, und die systematische Infragestellung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die Machtzentren verstärken Verwirrung und Chaos. Ähnliche Konfigurationen finden sich in anderen föderalen Ländern kontinentaler Größe. In Indien und Brasilien versuchen ebenfalls Bundesstaatsregierungen, die Verleugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und den Autoritarismus der Zentralregierung zu kompensieren. In Russland wiederum instrumentalisiert die jeweilige Zentralmacht wissenschaftliche Erkenntnisse und beruft sich auf die Verantwortung ihrer Verwaltungseinheiten, die mit äußerst schwacher politischer Autonomie gegenüber dem Zentrum ausgestattet sind.
In Spanien wird der Dauerkonflikt zwischen Madrid und den Hauptstädten der Metropolen auch in der gegenwärtigen sanitären und finanziellen Notlage fortgeführt. Zwar gibt es hier keinen politisch bedeutsamen Konflikt über die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf Covid-19, wie etwa in den Vereinigten Staaten oder Brasilien. Doch behindert das allgemeine Misstrauen, dass die Dezentralisierung zu Asymmetrien in der Kompetenzverteilung wie auch zu Ungerechtigkeit in der Verteilung fiskalischer Ressourcen und öffentlicher Finanzen geführt habe, die Koordination zwischen den verschiedenen Ebenen der action publique im Gesundheits- und Sozialbereich.
Ähnliche Beobachtungen können im italienischen Fall gemacht werden. Ab den 1980er Jahren wurde das Gesundheitswesen radikal dezentralisiert mit dem Ziel, Finanztransfers von reichen in arme Regionen zu begrenzen und tiefgehende Einschnitte in den staatlichen Gesundheitsausgaben durchzusetzen. Unlängst wurde das Krankenhauswesen rezentralisiert und relativ gesehen refinanziert (Mauro, Maresso, Guglielmo 2017). Doch hat die starke Dezentralisierung der 1980er Jahre in der Covid-19-Krise die interregionale Solidarität blockiert. Verlegungen von Patienten aus der Lombardei, dem italienischen Epizentrum der Virusinfektionen, in benachbarte, weit weniger stark betroffene Regionen wie Veneto oder Piemont konnten nicht oder nur mit großer Verzögerung organisiert werden (Rodrigues-Llanes et al. 2020). Die Lombardei, in der die politischen Gegner der nationalen Gesundheitssolidarität historisch stark sind, hat in der Corona-Pandemie 2020 den größten Tribut gezollt. Während Venetien und die Emilia-Romagna schnell Tests und Patientenisolierung organisierten, blieb die Reaktion des Gesundheitswesens in der Lombardei bis Ende Mai 2020 wirkungslos. Rom als Hauptstadt verfügt über zu wenig Ressourcen, um die gesundheitliche Versorgung auf der nationalen Ebene zu koordinieren. Die italienische Zentralregierung konzentriert sich vielmehr darauf, die Oberhand in der Koordination des sozialen und wirtschaftlichen Aufschwungs des Landes zu gewinnen. Zu beobachten ist ebenfalls, dass lokale Vereine, Solidaritätsnetzwerke und die Tradition der Freiwilligenarbeit mit dezentralisierten, aber in ganz Italien weit verbreiteten Aktionen der Solidarität „von unten“ herstellen, ja mehr oder weniger wirksam national koordinieren.
Eine Zwischenbilanz im Stress-Test der Corona-Krise
Sicherlich ist es zu früh, um eine endgültige vergleichende Bewertung der territorialen Organisationsformen im Gesundheitswesen vorzunehmen. Gleichwohl geben die Elemente, die die sozialwissenschaftliche Literatur zur Analyse der action publique an die Hand gibt, wertvolle Einblicke. Unabhängigkeit und Vielfalt wissenschaftlicher Erkenntnisse, Rückgriff auf die Zivilgesellschaft (und nicht deren Negation) in Krisenzeiten, dezentralisierte Wissensproduktion wie auch Handlungsmöglichkeiten, die auf dem Verantwortungsbewusstsein gesellschaftlicher Akteure beruhen, erscheinen eindeutig als Schlüsselelemente im Erfolg der Krisenbewältigung. Zugleich stellten genau diese Schlüsselelemente ein Manko in der action publique dar, die in Frankreich zu beobachten war.
Ergänzende Erklärungen erlauben auch die katastrophalen Erfahrungen, die in den USA auf den ideologischen Konflikt, in Spanien auf das fiskalpolitische Misstrauen oder in Italien auf die geradezu militante Inkompetenz bestimmter Regionalmächte zurückgehen. Die genannten Beispiele nationaler Konfigurationen erinnern an die Notwendigkeit, insbesondere in einer Krisensituation wenn schon nicht auf der Basis ein und desselben Projekts, so doch zumindest auf der Basis von gemeinsamen Werten einen Handlungsrahmen für alle Beteiligten zu schaffen und das Vertrauen zwischen den Beteiligten zu stärken. Ist dies nicht der Fall und kommen tiefe regionale Spaltungen wie in Südeuropa oder den Vereinigten Staaten hinzu und lehnen wie in den USA oder Brasilien die Machteliten auf wissenschaftlichen und rationalen Argumenten beruhende Debatten ab, sind demokratisch legitimierte Solidaritätspakte gefährdet.
Die zunehmenden Allianzen zwischen Obskurantisten, Marktbefürwortern, die jede öffentliche Regulierung ablehnen, und den radikalen Feinden jeglichen Sozialschutzes stellen eine Bedrohung für Gesundheits- und Sozialsysteme dar – und zwar eine stärkere als diejenige, die durch Spannungen zwischen Zentralisierungsverteidigern und Dezentralisierungsbefürwortern entsteht. Demokratie beruht darauf, dass die Mehrheit der politischen Kräfte die Existenz eines gemeinsamen Diskussionsraums akzeptieren. Über mehrere Jahrzehnte haben die Opposition zwischen den Verfechtern öffentlicher Regulierung und jenen der Marktregulierung einerseits und andererseits die Wertkonflikte zwischen den Vertretern von Traditionen (wie Nation, Familie und Autorität) und Vertretern der Moderne (kulturelle und moralische Vielfalt, Umweltschutz, Vorrang individueller Entscheidung vor kollektiver Disziplin) diesen Diskussionsraum strukturiert. Die Radikalität des anti-wissenschaftlichen Diskurses in den Vereinigten Staaten und Brasilien, aber auch hier und da in Europa, zeigt die Fragilität dieser so strukturierten Diskussionsräume.
Teil 2: Verstehen und Handeln angesichts der Corona-Krise: Was offenbart die Covid-19-Pandemie über die Herstellung gesundheits- und sozialpolitischer Solidaritäten in Europa (und anderswo)?
Die internationale und europäische Wissensproduktion im Gesundheits- und Sozialwesen: Koordinationsmechanismen in der Globalisierung
Neben der Bedeutung der infranationalen jeux d’échelles für die Herstellung von Solidarität offenbart die Corona-Krise zugleich die Tragweite trans- und internationaler Interaktionen für die Produktion von Wissen sowie für die Koordination der Bearbeitung der gesundheitsrelevanten und sozialen Probleme. In dieser Hinsicht führt sie vor Augen, was Paul-André Rosental am Beispiel der Geschichte der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) in der Zwischenkriegszeit für den Beginn des 20. Jahrhunderts und die Zwischenkriegszeit gezeigt hat (Rosental 2006). Wie der französische Historiker erläutert, sind die internationale Wissensproduktion und die zwischenstaatliche Koordination in den Bereichen Gesundheit und Soziales substanziell mit Widersprüchen und Konflikten verbunden: Einerseits treiben die trans- und internationalen Interaktionen die Dekommodifizierung der sozialen Rechte und des Gesundheitsschutzes voran, insbesondere dadurch, dass Arbeitsmobilität und Migration thematisiert werden. Sie tragen also zur Einhegung der globalisierten Märkte bei. Andererseits führen geopolitische Strategien der Akteure auf der internationalen Bühne dazu, dass Gesundheitsschutz und soziale Absicherung für imperialistische, protektionistische oder auch rassistische Ziele instrumentalisiert werden. Der internationale und innereuropäische Austausch von medizinischen Daten und Forschungsarbeiten sowie die internationale und innereuropäische Koordination in der Bearbeitung der sozialen Folgen in den Monaten, in denen Europa zum Epizentrum der Covid-19-Pandemie geworden ist, spiegeln die von Rosental für die IAO herausgearbeiteten Widersprüche und Konflikte deutlich wider. Nicht nur sind die Wissensproduktion und die Koordination mit den Realitäten nationaler Verwaltungs- und Produktionsstrukturen konfrontiert, sondern auch mit den geopolitischen Strategien und nationalökonomischen Egoismen nationaler Regierungsakteure. Was die Wissensproduktion betrifft, so sei an dieser Stelle angemerkt, dass Diskontinuitäten in der langfristigen Forschungsfinanzierung auf der nationalen Ebene und ein durch geopolitische Strategien und Marktlogiken verzerrter wissenschaftlicher Austausch auf der internationalen Ebene die Krisenbewältigung in der Corona-Pandemie maßgeblich behindern (Canard 12.03.2020; Marichalar 2020).
Internationale Organisationen stellen entscheidende Koordinierungsmechanismen für den wissenschaftlichen Austausch und für die Wissensproduktion im Allgemeinen dar. Die Covid-19-Krise hat in dieser Hinsicht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Vordergrund gerückt (Interview mit Auriane Guilbaud 2020); andere internationale Organisationen agieren mehr oder weniger in den Kulissen der internationalen Szene, wie etwa die IAO, die seit März 2020 Berichte über die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt und die informelle Wirtschaft veröffentlicht und Daten über den Schutz der Arbeitnehmer und die Arbeitslosigkeit zusammenstellt. Wie alle internationalen Organisationen versuchen sowohl die WHO als auch die IAO derzeit, die Definition und Bearbeitung der gesundheitlichen und sozialen Probleme zu strukturieren, indem sie internationale Standards bestimmen, Daten sammeln und Experten zusammenbringen. Zugleich stellen sie den staatlichen Akteuren Koordinierungsmechanismen für die Bearbeitung der Probleme zur Verfügung. Die Legitimität dieser Koordinierungsmechanismen beruht nicht zuletzt darauf, dass Gründung und Existenz der internationalen Organisationen auf die Entscheidungen ihrer Mitgliedsstaaten zurückgehen.
Internationales soziales Wissen zwischen Märkten und Geopolitik
Als „Orte multilateraler Diskussionen“, „an denen ein regelrecht internationales Sozialwissen aufgebaut worden ist“ (Kott/Lengwiler 2017, 18, 20), bringen internationale Organisationen, insbesondere seit 1945, eine Vielfalt von Akteuren zusammen, die über ein breites Spektrum an beruflichen Erfahrungen und Fähigkeiten verfügen und insofern auf der Basis ganz unterschiedlicher Sinnzusammenhänge handeln: Regierungsvertreter, Wissenschaftler, nationale und internationale Beamte, Sachverständige im Auftrag von internationalen Organisationen, von Regierungen, privaten Geldgebern oder Unternehmen, die Forschung und technologische Entwicklung finanzieren, Vertreter internationaler Berufs- oder Gewerkschaftsverbände (wie im Fall der IAO, dem einzigen tripartistischen Gremium auf internationaler Ebene), Vertreter von Nichtregierungsorganisationen usw. In dieser Hinsicht gibt es mehrere jeux d’échelles bzw. Interaktionsräume, die sich quer durch die Wissensproduktion ziehen und die Koordinationsmechanismen bei Solidaritätsherstellung beeinflussen.
Zwei dieser Interaktionsräume, die in internationalen Organisationen miteinander verstrickt sind, sind auf internationaler Ebene in der Covid-19-Krise und für die Bewältigung ihrer sozialen Folgen besonders wichtig. Zum einen treten die konfliktgeladenen Interaktionen zwischen den Verteidigern von Solidarität und Schutz gegen die globalisierten Märkte und den Befürwortern ausschließlicher Selbstregulierung der globalisierten Märkte und möglichst weitgehender Ausdehnung der Marktprinzipien auf den sozialen Bereich und das Gesundheitswesen ans Licht. Zum anderen charakterisieren die geopolitischen Konkurrenzen zwischen den Staats- und Regierungsvertretern die Bearbeitung der Probleme, die die Pandemie hervorgerufen hat. Wurden Gesundheits- und Sozialpolitiken, insbesondere mit Unterstützung der IAO, ab 1945 im Wesentlichen als Schutz vor Märkten konzipiert, so reduzieren sie sich ab den 1980er Jahren aufgrund neoliberaler Kritik auf Mindestleistungen. Diese Politiken werden unterstützt vom Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank, die beide die Selbstregulierung des Marktes verteidigen. Zu Beginn der 2000er Jahre machen insbesondere die OECD und die EU das Paradigma der „Sozialinvestition“ stark. Auf der Basis dieses Paradigmas werden Gesundheits- und Sozialpolitiken marktkompatibel und zugleich zu Bereichen individueller Investitionen erklärt. Genau diese Konzeption bildet den Hintergrund für die sozialen Ungleichheiten, die heute in der Covid-19-Pandemie aufbrechen.
Die Auswirkungen geopolitischer Interessen und damit verbundener Interaktionen auf die Wissensproduktion und die internationalen Koordinierungsmechanismen werden an den Kontroversen über die Rolle der WHO in der Bewältigung der Pandemie besonders deutlich. Nach den durch chinesische Behörden am 31.12.2019 bekanntgegebenen Lungenentzündungsfällen in Wuhan wurde die WHO zunächst beschuldigt, das geopolitische Spiel der chinesischen Regierung zu spielen. Dann vernachlässigten Regierungsvertreter die WHO-Erklärungen oder nutzen sie als Argument für protektionistische Maßnahmen. Gleichzeitig ist die WHO selbst gezwungen, mit den geopolitischen Interessen ihrer Mitgliedstaaten und den daraus folgenden intergouvernementalen Beziehungen vorsichtig umzugehen. Vor diesem Hintergrund lässt sich zum Beispiel erklären, warum die WHO im Januar 2020 gegen den Rat von Experten den Forderungen der chinesischen Behörden nachkommt und nicht sofort den internationalen Gesundheitsnotstand erklärt (Interview mit Auriane Guilbaud 2020). Schon in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts wurde das in internationalen Organisationen produzierte Wissen immer wieder für nationalistische, kommerzielle oder protektionistische politische Ziele instrumentalisiert und vereinnahmt. Man erinnere sich nur daran, dass die Durchsetzung des Arbeitsrechts und der Systeme sozialer Sicherheit auch für die Eugenik- und Rassenpolitik genutzt worden ist – und dies unter Mithilfe der Natur- und Sozialwissenschaften. In dieser Hinsicht gilt es „die Plastizität in der Anwendung“ internationaler Koordinierungsmechanismen zu analysieren (Rosental 2006, 134).
Eine solche Analyse der „Plastizität in der Anwendung“ von Wissen und Koordination, die auf internationaler Ebene und durch transnationalen Austausch produziert werden, ist heute umso notwendiger, als der allgemein zu beobachtende Rückzug auf national gerahmte Politik die Interdependenzen nicht zum Verschwinden bringt, die das nationale Gesundheitswesen und die nationalen Systeme sozialer Sicherheit mit der internationalen Welt und den globalen Märkten verstrickt. Es ist daher dringend notwendig, das international aufgebaute „Sozialwissen“ (Kott, Lengwiler 2017) im Hinblick auf Perspektiven zu analysieren, die ein jeu d’échelles zugunsten der Herstellung von Solidaritäten ermöglichen. Hierfür bieten die Normen und Rechte, die seit der Gründung des Sozialstaates zu Beginn des 20. Jahrhunderts in internationalen und regionalen Organisationen und Vereinigungen erarbeitet wurden, eine mögliche Grundlage. Sie erlauben, die internationalen Wissensproduktionen und Interaktionen zu überprüfen. Zunächst einmal stellen diese Normen und Rechte sicher, dass die Herstellung von Solidaritäten in den geostrategischen und auf globale Märkte fixierten Interaktionen als politisches Thema existiert. Sie stellen Stolpersteine dar, die von den Akteuren genutzt werden können, um die lokalen Realitäten der Solidaritätsherstellung zu problematisieren. Zweitens beruhen die rechtlichen und institutionellen Arrangements auf internationaler Ebene seit 1945 zunehmend auf einer „de-territorialisierten“ Konzeption der sozialen Rechte (Fertikh 2019, Koenig 2005). Die WHO etwa basiert seit ihrer Konstituierung im Jahr 1946 auf dem Grundsatz: „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.“ Diese de-territorialisierte Konzeption versieht das Individuum mit einem Anspruch auf Wohlergehen, unabhängig von seiner Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat und einem Sozialversicherungssystem wie auch unabhängig von seinem Status auf den Arbeitsmärkten oder globalisierten Märkten. Ausgehend hiervon sind internationale Regelungen vorstellbar, die erlauben, die Marktbeherrschung einzuhegen wie auch die Bewertung von Gesundheits- und Sozialpolitiken für mehr Parameter als nur für Kosten- und Ausgabenberechnungen zu öffnen (Farahat 2020).
Die Europäische Union im panepidemiologischen Mahlstrom
In der EU beruht der Zugang zu sozialen Rechten auf der Zugehörigkeit zu einem Mitgliedsstaat und auf der Teilnahme am europäischen Binnenmarkt. Im Weiteren kommen eine ganze Reihe von de-territorialisierten rechtlichen und administrativen Regelungen und Verfahren zum Tragen: das Unionsbürgerschaftsregime, die Portabilität sozialer Rechte, die EU-Regelungen für Grenzgänger, die Europäischen Betriebsräte, die Anerkennung der europäischen Gewerkschaftsverbände, insbesondere im Rahmen des Wirtschafts- und Sozialausschusses, die EU-Fonds (wie der Europäische Sozialfonds ESF und der Europäische Fonds für die Hilfe für Bedürftige FEAD) oder die Offene Methode der Koordinierung (OMK). Die Kommission und der Europäische Gerichtshof (EuGH) haben sich in verschiedenen Bereichen und jeweils in unterschiedlichem Ausmaß im Laufe der Geschichte als zentrale Akteure der Verflechtungen nationaler und supranationaler Rechts- und Verwaltungskonzeptionen etabliert (Fertikh 2016, Mechi 2017, Graziano et al. 2013). Beide werden durch jeux d’échelles charakterisiert, die zulasten europäischer Solidaritäten zu Konflikten zwischen den Vertretern der verschiedenen Generaldirektionen führen (Canihac, Laruffa 2018). Diese Konflikte spiegeln die oben in Bezug auf die internationale Ebene beschriebene Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Befürwortern von Gesundheit und sozialem Schutz gegen den Markt und den Protagonisten der Kommodifizierung von Solidarität wider – und zwar insofern, als dass die Kommission explizit und der EuGH indirekt seit den 2000er Jahren Gesundheits- und Sozialpolitiken fördern, die mit den Marktlogiken kompatibel sind und eine individuelle Investition in Gesundheit und sozialen Schutz vorsehen.
Jeux d’échelles in der institutionellen Architektur des EU-Raums
Die Akteure, die zwischen den 1950er und 1970er Jahren die Generaldirektion (GD) für soziale Angelegenheiten (GD V, jetzt GD Employment, Social Affairs and Inclusion, GD EMPL) u. a. mit der Unterstützung der internationalen und europäischen Gewerkschaftsverbände und auf der Basis der in der IAO erarbeiteten Expertise den Aufbau eines europäischen Systems soziale Sicherheit vorantrieben (Wieters, Fertikh 2019), sind nach und nach von den Protagonisten der neoliberalen Kritik, die vor allem von den Mitgliedern der GD für Wirtschaft und Finanzen (DG ECOFIN) vertreten wurde, verdrängt worden. Im Rückblick scheint die Einheitliche Europäische Akte von 1986 der letzte Vertrag gewesen zu sein, in dem eine Dekommodifizierung des gemeinsamen europäischen Markts zumindest partiell angestrebt wurde. Seit den 2000er Jahren befürwortet die Kommission einen marktorientierten sozial- und gesundheitspolitischen Ansatz, der auf die „Aktivierung“ der Menschen für den Arbeitsmarkt ausgerichtet ist. Gleichzeitig haben sich die Definitionen und die Bearbeitungsformen von Problemen im Gesundheits- und Sozialwesen allmählich von Konzeptionen gelöst, die Ungleichheiten und die Herstellung von Solidaritäten in den Fokus stellen. Gesundheitsrelevante und soziale Probleme werden mehr und mehr als Diskriminierungen problematisiert. Insofern stehen Gesundheits- und Sozialpolitiken im Kontext des Antidiskriminierungskampfs und konzentrieren sich auf die Realisierung der Rechte bestimmter sozialer Gruppen (Rowell 2018). In dieser Hinsicht werden die EU-Mittel spezifischen Projekten zugewiesen, die an öffentliche Einrichtungen, Vereine oder Wohlfahrts- und Gewerkschaftsverbände nach den jeweiligen von den Mitgliedstaaten bestimmten Kriterien vergeben werden. Diese Form von europäischer Sozialpolitik muss, im Gegensatz zu dem, was Akteure der GD für soziale Angelegenheiten und der europäischen Gewerkschaftsbewegung in den 1950er und 1960er Jahren durchzusetzen versuchten, weder von einer langfristigen europäischen Reflexion noch von europäischen Problematisierung der Ungleichheiten gerahmt werden.
Der EuGH, der zweite zentrale Akteur in der Verflechtung von territorialstaatlicher Souveränität und nationalen Marktordnungen mit den supranationalen Rechten, die den gemeinsamen europäischen Markt regulieren, ist in den gesundheits- und sozialpolitischen Bereichen sicherlich weniger sichtbar als die Kommission. Er spielt nichtsdestotrotz eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung und Auslegung des europäischen Regimes des social citizenship, wie z.B. bezüglich der Portabilität sozialer Rechte oder der Gleichstellung von Drittstaatsangehörigen (Migranten) im Zugang zu Rechten (Farahat 2016). Die EuGH-Richter haben zunächst eine weite Auslegung der bürgerrechtlichen Dimensionen der Unionsbürgerschaft stark gemacht – und zwar seit dem Urteil in der Rechtssache Grzelcyk (2001), das die Unionsbürgerschaft (und nicht die Zugehörigkeit zu einem Mitgliedstaat) zur Bedingung für den Zugang zu beitragsunabhängigen Sozialleistungen macht. Doch scheinen sie seit 2015 diese Doktrin aufgegeben zu haben. Dies führt zu einer „sozialen Stratifikation“ des Freizügigkeitsrechts, das im Zentrum des Unionsbürgerschaftsregimes steht (Farahat 2017). Der Zugang zu sozialen Rechten wird an eine Beschäftigung oder an den Arbeitnehmerstatuts gebunden, und Kriterien wie die Dauer des Aufenthalts oder familiäre oder andere Bindungen im jeweiligen Mitgliedsland werden in den Hintergrund gedrängt (Tietze 2018).
Diese und ähnliche Maßstabsverschiebungen innerhalb der europäischen Institutionen charakterisieren ebenfalls die intergouvernementalen Interaktionen zwischen den Mitgliedsstaaten. Geprägt durch wirtschaftliche Asymmetrien und Einflussunterschiede in der europäischen Entscheidungsfindung konstituieren diese Interaktionen einen „zwischenstaatlichen Föderalismus“, der dem Wirken der stärksten Mitgliedsstaaten auf dem Binnenmarkt und in der Währungsunion freien Lauf lässt (Lechevalier 2018). Der „zwischenstaatliche Föderalismus“ verstärkt die nationalen Egoismen und die marktwettbewerblichen Interessen in der Gestaltung von Sozialpolitik. Dies hat in der europäischen Covid-19-Krise dazu geführt, dass die Grundprinzipien der Union – der europäische Binnenmarkt und die Freizügigkeit – wie auch die Europäisierung der nationalen Gesundheitssysteme – gemeinsame Herstellung medizinischer Geräte und Medikamente, Freiheit medizinischer Dienstleistungen und Freizügigkeit des medizinischen und pflegerischen Personals – ausgehebelt worden sind (Hassenteufel 2013). 2018 waren etwa in Deutschland zwischen 60% und 70% der 55.000 nach Nationalität und Ausbildung ausländischen Ärzte Unionsbürger, darunter Rumänen (4.666), Griechen (3.169) oder Italiener (1.511) (Ausländische Ärzte in Deutschland 31.12.2018). Die einseitigen Maßnahmen der Mitgliedsstaaten zu Beginn der Corona-Pandemie in Europa – zum Beispiel als Deutschland und Frankreich Mitte März 2020 beschlossen, den Export von Masken und medizinischer Ausrüstung innerhalb der EU zu verbieten, und als Deutschland, gefolgt von etwa zehn weiteren Mitgliedsstaaten, am 15. März seine Grenzen schloss – haben nicht nur die Europäisierung des Gesundheitssektors in erschütternder Weise außer Kraft gesetzt, sondern auch das multi-situierte Berufs- und Familienleben tausender Menschen im EU-Raum zum Erliegen gebracht.
Die Mitgliedstaaten haben im Laufe der Zeit ihre verschiedenen Abschottungsmaßnahmen relativiert und die Situationen der Unionsbürger der anderen Mitgliedsstaaten stärker in Betracht gezogen: Krankenhäuser in Deutschland haben Patienten aus Frankreich oder Italien aufgenommen, deutsche Unternehmen konnten schließlich doch medizinische Geräte nach Italien senden, die Tschechische Republik schickte Schutzausrüstung nach Italien und Spanien, rumänisches Krankenhauspersonal wurde auf der Basis des von der EU-Kommission eingerichteten Emergency Response Coordination Centre nach Bergamo in Italien gesendet usw. Im Sinne des „wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts und [der] Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“ (Art. 3, 3 EUV) sind diese Gesten der Solidarität eine Selbstverständlichkeit, ihre Aufzählung als nationale Solidaritätsaktionen hingegen klingen wie aus einer anderen Epoche. Die Europäisierung der Lebensweise der Bürger scheint weiter fortgeschritten zu sein als das Handeln ihrer nationalen Regierungen. Aufgrund der Befürchtung, die französische Grenzschließung könne zu einem Zusammenbruch des Krankenhauswesens führen, schloss die luxemburgische Regierung zum Beispiel mit den französischen Gesundheitsbehörden eine Vereinbarung: Im Austausch dafür, dass die luxemburgischen Krankenhäuser Covid-19-Patienten aus Ostfrankreich aufnehmen, erlaubten die französischen Behörden, den in luxemburgischen Krankenhäusern arbeitenden französischen Grenzgängern die Überschreitung der Grenze. Da sich ihre Ärzte auf der österreichischen Seite der Grenze befinden, wurde wiederum vielen deutschsprachigen Italienern in Südtirol der Zugang zu jeglicher medizinischen Versorgung verwehrt, als Österreich seine Grenzen schloss.
Spätestens seit der Erklärung ihrer Präsidentin vom 15. März 2020 über die verheerenden Folgen des Exportverbots für medizinische Geräte im europäischen Raum hat die Kommission versucht, die Verstöße der mitgliedstaatlichen Regierungen gegen die EU-Prinzipien zu korrigieren. So erließ die Kommission beispielsweise Richtlinien für den Grenzverkehr, „to protect health and ensure the availability of goods and essential services“; richtete eine zunächst 37 Milliarden Euro umfassende Coronavirus Response Investment Initiative I und II ein, die aus nicht genutzten Strukturfonds finanziert wird; schlug ein europäisches Arbeitslosenrückversicherungsprogramm (SURE) in Höhe von 100 Milliarden Euro vor etc. (Börzel/Risse 2020). Die Europäische Zentralbank, die zum Beispiel das Pandemic Emergeny Purchase Programme (PEPP) aufgelegt hat, um die nationalen Regierungen mit ausreichender Liquidität zu versorgen, rief die Regierungen der Eurozone Anfang April 2020 durch die Stimme ihrer Präsidentin ebenfalls zu mehr Abstimmung und Solidarität zwischen den Mitgliedern der Eurozone in der Finanz- und Geldpolitik auf. Bisher haben die Vertreter der europäischen Institutionen trotz dieser Interventionen die Regierungsvertreter der Mitgliedstaaten nur begrenzt davon überzeugen können, eine europäische Perspektive bei der Bewältigung der Gesundheitskrise und ihrer sozialen wie auch wirtschaftlichen Folgen einzunehmen. Die sozialen Ungleichheiten, die bereits vor der Covid-19-Pandemie im europäischen Raum erheblich waren, werden nicht als ein europäisches Problem, sondern vielmehr als Einzelprobleme nationaler Arbeitsmärkte, Gesundheits- und Sozialsysteme und Wirtschaftsstrukturen bearbeitet. Ob der deutsch-französische Kompromiss vom 18. Mai 2020 und der Vorschlag der Europäischen Kommission vom 26. Mai 2020, gemeinsame und insofern EU-solidarische Schulden aufzunehmen, einen grundlegenden Perspektiv- und Maßstabswechsel in den europäischen Interaktionen einleiten werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine offene Frage. Die wachsende Kontrolle der Zirkulation des Virus in den verschiedenen Mitgliedsstaaten hätte eine Gelegenheit geboten, den Realitäten der europäisierten gesellschaftlichen Beziehungen stärker Rechnung zu tragen und vor allem EU-Recht und die Rolle der EU-Institutionen im Hinblick auf die in den EU-Verträgen deklarierte Solidarität neu zu interpretieren.
Zu dem Zeitpunkt, an dem wir diesen Text schreiben, und in dem Maße, wie die verschiedenen europäischen Regierungen beginnen, die Grenzen zu öffnen, sind sowohl die europäische Wissensproduktion als auch die europäischen Koordinierungsmechanismen in den nationalstaatlichen Egoismen und in der (fast zwanghaften) Sorge um die nationalen Souveränitätsrechte verfangen. Abgesehen von diesen zwischenstaatlichen Problemen in der Bewältigung der gesundheitlichen und sozialen Krise in der EU unterstreichen die zu beobachtenden Kontroversen zudem die fixe Idee, dass die Umsetzung der Solidarität vom Funktionieren der national gerahmten Märkte abhängt. In dieser Hinsicht scheinen die Wissensproduktion hinsichtlich des Gesundheitswesen und der sozialen Folgen wie auch die europäische Koordinierung von den Verhandlungen der Finanzminister der Eurogruppe, in der zwar die von der Corona-Krise am stärksten betroffenen Länder, aber nicht alle EU-Mitgliedstaaten vertreten sind, abhängig zu sein. Unter diesen Bedingungen werden den Zielen, den Euro zu stabilisieren, die Wettbewerbsfähigkeit auf den globalisierten Märkten zu gewährleisten und vorrangig die Höhe der Sozialausgaben zu kontrollieren, die Priorität gegeben (Queiroz 2020). Darüber hinaus haben einige Mitgliedstaaten, wie z.B. Deutschland und Österreich, trotz der Schließung ihrer innereuropäischen Grenzen Ausnahmeregelungen für die Einstellung oder Wiederbeschäftigung von Saisonarbeitern in der Landwirtschaft, von Haushaltshilfen für ältere Menschen oder von entsendeten Arbeitnehmern auf dem Bau etwa aus Rumänien, Ungarn oder Bulgarien erlassen. Diese Ausnahmeregelungen betreffen vor allem prekäre Arbeitsmarktsektoren mit geringem oder gar keinem sozialen Schutz. Sie erwecken insofern den Eindruck, dass die Freizügigkeit der europäischen Bürger vor allem ein Instrument wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit ist und nicht in ein social citizenship eingebettet werden muss.
Angesichts der Herausforderungen, die die Corona-Pandemie für alle Menschen im EU-Raum mit sich bringt, und auf der Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die verschiedenen Faktoren der Ausbreitung des Covid-19 stellt sich die Frage, warum eine ganze Reihe von Schlüsselakteuren in der EU ihre Reaktionen auf die Krise, u.a. im Hinblick auf die Aufhebung der Kontaktsperren und Lockdowns, nicht harmonisieren und keine Solidaritätsmaßnahmen auf der Grundlage der Programme und Maßnahmen der Kommission und anderer EU-Institutionen vorschlagen. Zu einer solchen Harmonisierung gehört nicht nur ein Austausch zwischen den mitgliedstaatlichen Gesundheits-, Arbeits- und Sozialministern, sondern vor allem auch die Einbeziehung von Vertretern regionaler und kommunaler Behörden (z.B. des Ausschusses der Regionen) wie auch von Vertretern der Sozialpartner (z.B. des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses). Die Programme und Maßnahmen der EU können und müssen zweifellos aufgrund ihrer Defizite, Widersprüche, Langsamkeit oder Unzulänglichkeit kritisiert werden. Dennoch bieten sie eine strukturelle Grundlage für eine andere innerinstitutionelle Verflechtung innerhalb der EU und zwischen den EU-Instanzen und den Mitgliedsstaaten – allerdings unter der Bedingung, dass gesellschaftliche Akteure, die Teil der action publique sind, stärker an Wissensproduktion und Koordination im gesundheits- und sozialpolitischen Bereich beteiligt werden.
Wissensproduktion und Mechanismen der Koordination– blockiert in ihren eigenen jeux d’échelles?
Es ist nicht der Moment, vereinfachend zu bilanzieren. Doch verdeutlicht die Covid-19-Krise, dass die von den EU-Institutionen spätestens seit dem Maastrichter Vertrag 1992 favorisierte Unterordnung gesundheits- und sozialpolitischer Probleme unter die Imperative marktwirtschaftlichen Wettbewerbs und die nationalen Egoismen der Mitgliedsstaaten das Projekt der europäischen Integration und die Gesundheit und soziale Sicherheit aller in der EU lebenden Menschen gefährden. Auf der europäischen Ebene spiegelt sich in dieser Hinsicht die Notwendigkeit einer „Mobilisierung des Einverständnisses“ wider, die Peter Hall für Deutschland als eine Tugend der action publique im sozioökonomischen Bereich beschrieben hat (Hall 1997).
Wie wir im ersten Teil unseres Texts gezeigt haben, ist auf der nationalen Ebene ein Einverständnis angesichts der Covid-19-Krise in den verschiedenen jeux d’échelles der gesundheits- und sozialpolitischen Wissensproduktion und Koordination mehr oder weniger zentralistisch und autoritär mobilisiert bzw. durchgesetzt worden. Für den Erfolg der Mobilisierung oder der Durchsetzung dieses Einverständnisses stellen - so das Ergebnis unserer Überlegungen, die letztendlich mit den aus der Literatur zur Analyse der action publique gut bekannten Kenntnisse übereinstimmen - Unabhängigkeit und Pluralismus der wissenschaftlichen Expertise, Rückgriff auf die Zivilgesellschaft (statt deren Negation), eine Dezentralisierung der Wissensproduktion wie auch ausreichender Handlungsspielraum der direkt betroffenen Akteure Schlüsselelemente dar.
Die „Mobilisierung des Einverständnisses“, sei es aus Tugend oder mithilfe staatlicher Durchsetzung, hat die Zirkulation des Virus verringert und mehrere tausend weitere Todesfälle in Europa verhindert. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob das Einverständnis den sozialen Folgen der Gesundheitskrise standhalten kann. Sowohl die Kontroversen zwischen den Gebietskörperschaften und den föderalen oder nationalen Regierungen in den verschiedenen europäischen Ländern als auch die Konflikte auf europäischer Ebene deuten darauf hin, dass die Corona-Pandemie die alten politischen und sozialen Spaltungslinien nicht zum Verschwinden gebracht, sondern im Gegenteil verschärft hat. Angesichts der Verflechtung dieser Spaltungslinien sowohl mit der Europäisierung gesellschaftlicher Beziehungen als auch mit den globalen Wirtschafts- und Finanzmärkten können Solidaritäten gleichwohl nicht mehr exklusiv im nationalen Rahmen hergestellt werden. Die Covid-19-Krise bringt insofern die Notwendigkeit ans Licht, Solidaritäten stärker transnational zu konzipieren. Die Zukunft wird zeigen, ob sich eine solche Politik, etwa in Form der EU-solidarischen Kreditaufnahmen oder in Form EU-koordinierter Gesundheitsversorgung, durchsetzen und den von verschiedenen regierungspolitischen Akteuren angekündigten historischen Wendepunkt darstellen wird. Jede transnationale Solidaritätskonzeption erfordert jedoch, die gegenwärtig vorgenommene Unterordnung der sozialen Rechte und Leistungen unter marktwirtschaftliche Prioritäten zu überdenken.
[1] In Anlehnung an die französische Politikwissenschaft verstehen wir unter action publique staatlich definierte und durch Behörden umgesetzte public policies und die Tätigkeiten von Interessengruppen und anderen gesellschaftlichen Akteuren, die an der Definition öffentlicher Probleme und an der Gewährleistung von öffentlichen Dienstleistungen und Gütern – in diesem Fall in Bezug auf die Herstellung von Solidaritäten im Gesundheits- und Sozialbereich – beteiligt sind (vgl. Commaille 2014).
Bibliographie
Gilles Gressani: „Le coronavirus à l’échelle régionale“, (17.3.2020), https://legrandcontinent.eu/fr/2020/03/17/le-coronavirus-a-lechelle-pertinente/ (22.4.2020).
Béland, Daniel; Lecours, André (2004). „Nationalisme et Protection Sociale: Une Approche Comparative.“ Canadian Public Policy / Analyse De Politiques, 30(3), 319–331.
Börzel, Tanja A.; Risse, Thomas (2020): „Here we go again. The covid 19 and the EU crisis.“ https://www.scripts-berlin.eu/listen-read-watch/blog/here-we-go-again-the-eu-and-the-covid-19-crisis_/index.html
Canihac, Hugo; Laruffa, Francesco (2018): „Soziale Marktwirtschaft und Europäisches Sozialmodell: Über den Wandel diskursiver Leitbilder eines >Sozialen Europa<“. In: Karim Fertikh, Heike Wieters, Bénédicte Zimmermann (Hg.), Ein soziales Europa als Herausforderung. L’Europe sociale en question, Frankfurt a.M: Campus, 87-116.
Clarke, J. (2005): „Welfare States as Nation States: Some Conceptual Reflections“. Social Policy and Society, 4(4), 407-415.
Collective 9 (4): 59-64 https://wp.me/P1Bfg0-4Wa
Commaille, Jacques (2014): „Sociologie de l’action publique.“ In: Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot und Pauline Ravinet (Hg.): Dictionnaire des politiques publiques. Paris: Les Presses Sciences Po, 599–607.
European Commission (26.6.2020): „Coronavirus: European solidarity in action“. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_en
Elazar, Daniel J. (1997): „Contrasting Unitary and Federal Systems“. Revue internationale de science politique, 18(3), 237‑251.
Eloire, Fabien et al. (2020): „La caisse de l’Etat social mise en lumière par la pandémie. Retour sur un lent processus de délitement.“ Revue Française de Socio-Economie, hors-série, 23-58.
Esping-Andersen, Gøsta (1990): Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.
Evers, Adalbert (1990): Shifts in the welfare mix: their impact on work, social services and welfare policies. Frankfurt a.M.: Campus.
Farahat, Anuscheh (2016): „Solidarität und Inklusion - Umstrittene Dimensionen der Unionsbürgerschaft.“ Die Öffentliche Verwaltung 69 (2).
Farahat, Anuscheh (2017): „Wettbewerb um Migranten? Die Stratifikation von Freizügigkeitsrechten in der EU.“ In: Stefan Kadelbach (Hg.): Wettbewerb der Systeme – System des Wettbewerbs in der EU. Baden-Baden: Nomos, 101–121.
Farahat, Anuscheh (2020): „Against the Apocalyptic Swan Song“, Verfassungsblog https://verfassungsblog.de/against-the-apocalyptic-swan-song/
Fertikh, Karim (2016): „La construction d’un «droit social européen». Socio-histoire d’une catégorie transnationale (années 1950-années 1970).“ Politix 29 (115), 201–224.
Fertikh, Karim (2019): „Du droit international au droit européen. Une sociologie du droit social comme entreprise de cause.“ Revue française de science politique 69 (1), 137–156.
Fertikh, Karim (2020): „Le point sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19 en Allemagne.“https://mailchi.mp/paris-sorbonne/le-ciera-est-sur-youtube-dcouvreznotre-srie-instantans?e=0fad13b475
Gilbert, Claude; Henry, Emmanuel; Bourdeaux, Isabelle (2009): „Lire l’action publique au prisme des processus de définition des problèmes.“ In: Claude Gilbert und Emmanuel Henry (Hg.): Comment se construisent les problèmes de santé publique. Paris: La Découverte, 9–33.
Giraud, Olivier; Lucas, Barbara; Falk, Katrin; Kümpers, Susanne; Lechevalier, Arnaud (2014): „Innovations in Local Domiciliary Long-Term Care: From Libertarian Criticism to Normalisation.“ Social Policy and Society 13, 433-444.
Giraud, Olivier (2005): „Nation et globalisation. Mécanismes de constitution des espaces politiques pertinents et comparaisons internationales.“ In Barbier, Jean-Claude; Letablier, Marie-Thérèse (Hg.): Politiques sociales. Enjeux méthodologiques et épistémologiques des comparaisons internationales. Bruxelles, P.I.E./Peter Lang, 95-115.
Gray, Virginia; Lowery, David; Monogan, James; Godwin, Erik K. (2009): „Incrementing Toward Nowhere: Universal Health Care Coverage in the States“, Publius: The Journal of Federalism, 40 (1), 82-113.
Graziano, Paolo R.; Jacquot, Sophie; Palier, Bruno (2013): „Usages et Européanisation. De l’influence multiforme de l’Union européenne sur les réformes des systèmes nationaux de protection sociale.“ Politique européenne 40 (2), 94-118.
Hall, Peter A. (1997): „The Political Economy of Adjustment in Germany.“ In: Naschold, Frieder; Soskice, David; Hanché, Bob; Jürgens, Ulrich (Hg.), Ökonomische Leistungsfähigkeit und institutionnelle Innovation - Das deutsche Produktions- und Politikregime im globalen Wettbewerb, Berlin, Sigma, 293-317.
Hassenteufel, Patrick (2013): „Quelle européanisation des systèmes de santé ?“, Informations sociales 175 (1), 48–59.
Henry, Emmanuel (2009): „Rapports de force et espaces de circulation de discours. Les logiques des redéfinitions du problème de l’amiante.“ In: Claude Gilbert und Emmanuel Henry (Hg.): Comment se construisent les problèmes de santé publique. Paris: La Découverte,155–174.
Kazepov, Yuri (2010): „Rescaling Social Policies towards Multivel Governance in Europe: Some Reflections on Processes at Stake and Actors Involved.“ In Kazepov, Yuri (Hg.): Rescaling social policies: towards multilevel governance in Europe. Volume 1, Farnham: Ashgate, 35‑72.
Keating, Michael (2009): „Social citizenship, solidarity and welfare in regionalized and plurinational states.“ Citizenship Studies, 13 (5), 501-513.
Koenig, Matthias (2005): Menschenrechte. Eine Einführung. Frankfurt a. M.: Campus.
Kott, Sandrine; Lengwiler, Martin (2013): „Expertise transnationale et protection sociale“, Revue d’histoire de la protection sociale 10(1), 9-21.
Lafore, Robert (2004): „La décentralisation de l’action sociale - L’irresistible ascension du 'département providence'.“ Revue française des affaires sociales, 58 (4),19‑34.
Lechevalier, Arnaud (2018): „Social Europe and Eurozone crisis: The divided states of Europe.“ Culture, Practice & Europeanization 3 (3), 5–29.
Mauro, Marianna; Maresso, Anna; Guglielmo, Annamaria (2017): „Health decentralization at a dead-end: towards new recovery plans for Italian hospitals.“ Health Policy, 121 (6), 582-587.
Mechi, Lorenzo (2017): „Consultation technique et légitimation politique : La participation des experts aux premiers pas de la politique sociale européenne (1958-1975).“ Revue d’histoire de la protection sociale 10 (1), 102-123.
Queiroz, Regina (2020): „Quo vadis European Union?“ Social Epistemology Review and Reply Collective.
Rodriguez-Llanes J.M.; Castro Delgado R, Pedersen M.G.; Arcos González P.; Meneghini M. E-pub: 6 April 2020: „Confronting COVID-19: Surging critical care capacity in Italy.“ [Submitted]. Bull World Health Organ.
Rolland, Christine; Pierru, Frédéric (2013): „Les Agences Régionales de Santé deux ans après : une autonomie de façade.“ Santé publique, 25(4), 411–419.
Rosental, Paul-André (2006): „Géopolitique et Etat-Providence. Le BIT et la politique mondiale des migrations dans l’entre-deux guerres.“ Annales, Histoire, Sciences Sociales 61 (1), 99–134.
Rowell, Jay (2018): „Die Entstehung einer europäischen sozialen Kategorie: Wie Wissen 80 Millionen behinderte Europäer ans Licht bringt.“ In: Karim Fertikh, Heike Wieters, Bénédicte Zimmermann (éd.), Ein soziales Europa als Herausforderung. L’Europe sociale en question, Frankfurt a. M.: Campus, 141-163.
Tietze, Nikola (2018): „Legal Imagination am Europäischen Gerichtshof: Erzählungen europäischer Richter über Gleichbehandlung und die Kategorisierung des Sozialen.“ In: Karim Fertikh, Heike Wieters, Bénédicte Zimmermann (Hg.), Ein soziales Europa als Herausforderung. L’Europe sociale en question, Frankfurt a. M.: campus, 323-350.
Tietze, Nikola (2019): „Jeux d’échelles. Reflexionen über ein methodisches Prinzip und eine analytisches Beschreibungskategorie.“ Glossar der Missverständnisse, https://rm2.hypotheses.org/1046
Wieters, Heike; Fertikh, Karim (2019): „Ringen um ein soziales Europa. Gewerkschaften auf dem Weg nach Brüssel, 1950er bis 1970er Jahre.“ In: Monika Eigmüller, Nikola Tietze (Hg.), Ungleichheitskonflikte in Europa. Jenseits von Klasse und Nation. Wiesbaden: Springer VS, 93-111.
Virale Evolution. Vom worst case und Handlungsimperativen
Erstveröffentlichung am 03. April 2020 auf der Website des Centre Marc Bloch
Andrea Kretschmann
Andrea Kretschmann, Soziologin und Kriminologin, ist seit 2015 Forscherin am Centre Marc Bloch, wo sie den Schwerpunkt "Staat, Recht und politischer Konflikt" mitleitet. Aktuell forscht sie über Deeskalationsstrategien bei Demonstrationen in Europa sowie über das Policing von Protestbewegungen. Sie hat vielfach zum Thema publiziert und ist Mitherausgeberin der Reihe "Verbrechen & Gesellschaft" und des Kriminologischen Journals.
Das Kommende hätte man erahnen können – und hat es doch zu spät vorausgesehen. Im politischen Denken der Regierungen von Bund und Ländern schlägt das Virus nun umso drastischer zurück. Denn ihre Maßnahmen stützen diese auf die Antizipation möglicher Zukünfte, sie entwerfen Szenarien und gestehen dem worst case dabei eine prominente Stellung zu. Wie ein Schatten überlagert er die Gegenwart und beschwört eine drohende Zukunft herauf. Das Denken in worst cases formuliert eine Dringlichkeit; es setzt einen Handlungsimperativ, der etablierte Begründungszusammenhänge für politische Maßnahmen auszuhebeln und Verfahrenswege abzukürzen vermag. Unabhängig von der tatsächlichen Wirksamkeit der Maßnahmen, die hier keiner Evaluation unterzogen werden sollen und die zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin kaum zu beurteilen sind, ist es der worst case, der die massivsten kollektiven Grundrechtseingriffe in der Geschichte der Bundesrepublik – Ausgangssperre, Kontaktverbot, Schließungen usw. – bedingt. Die Politik greift damit auf eine etablierte Krisentechnologie zurück.
***
Szenarien werden verwendet, um Gefahren antizipierbar zu machen, die sich in ihrer Tragweite nicht eindeutig eingrenzen lassen. Sie entwerfen Zukunftsverläufe, die in politischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht noch im Ungewissen liegen. Ist der vorrangige Umgang mit der Zukunft seit der Moderne von Extrapolationen gegenwärtiger Ereignisse oder früherer Erfahrungen bestimmt, um von hier aus Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, so ist der vorsorgende Blick im Fall des Szenarios anders gelagert als die Stochastik. Szenarien bedienen sich nicht des Mittelwerts vergangener Geschehnisse oder Indikatoren der Gegenwart, um von hier aus Ableitungen zu treffen. Entsprechend kalkulieren sie nichts. Zwar nehmen sie Risikowerte auf und integrieren sie in ihre Modelle. Anders als Risikokonzeptionen aber stützen Szenarien sich nicht selbst zentral auf die Probabilistik. Ihr Zweck ist nicht die zahlenmäßige Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Zukunftsverlaufs, sondern das Aufzeigen der Eigenarten und Konsequenzen des konkreten Eintrittsfalls selbst. Insofern wagen Szenarien keine Vorhersagen, sondern sie entwerfen mögliche Zukünfte.
Es ist dies eine Denkweise, die sich am Unbekannten orientiert, an einem möglichen Ereignis, das sich aus dem Mittelwert vergangener Geschehnisse oder Indikatoren der Gegenwart kaum mit Sicherheit ableiten, wenngleich nur mit ihrer Hilfe denken lässt. Oft als singulär gerahmt, als vollkommen andersartig und unbekannt, wird auf Geschehnisse abgezielt, die bislang noch gänzlich außerhalb des Bereichs bekannter Wirkungszusammenhänge liegen könnten. Ausgerichtet mithin an einer Zukunft, die jeglichen Vergleichs entbehrt und sich insofern als entsprechend un-berechenbar erweisen muss, stehen derartige Denkweisen nicht für die Identifizierung bekannter Risiken. Sie formulieren neue Ungewissheiten. Vor diesem Hintergrund scheint es kaum ausreichend, die Erwartung und Aufmerksamkeit allein auf das als ‚wahrscheinlich‘ Gesicherte zu richten, vielmehr bedarf es der Antizipation möglicher Ereignisse und Verläufe.
***
Derartiges zeigt sich im politischen Umgang mit der Pandemie. Schnell wurde auf die Geschehnisse als historisches Ereignis umwälzenden Charakters rekurriert. Sie wird seit mehreren Wochen als die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gehandelt. Das Kommende zu denken, erweist sich jedoch als schwierig. Die Dynamik der viralen Evolution lässt sich aus dem hierzulande Vertrauten nur schwer ableiten: Die Bedingungen, die in Ländern wie Italien oder China vorherrschen, gelten als mit Deutschland schwer vergleichbar. Das betrifft etwa die politische und administrative Struktur des Staates, das betrifft die demografischen Proportionen und sozialen Verhältnisse junger und alter Menschen, das betrifft die Luftverschmutzung und die Beschaffenheit des Gesundheitssystems. Aufgrund geringer Kenntnisse über die Relationen von Virus und Gesellschaft liegt hier ein Spiel mit vielen Unbekannten vor.
Eine derartig unvollständige Eingrenzbarkeit stellt sich dann als Problem, wenn Zukunft als katastrophal vorgestellt wird, aber wenn ihr Eintreten (in welcher Form auch immer) als garantiert angesehen wird. Die Verdopplungsgeschwindigkeit der Ausbreitung des Virus etwa sagt dann zu wenig aus. Zugleich muss es deshalb darum gehen, sich zur Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung keinen failure of imagination zu leisten. Es ist diese Situation, die – um es mit dem geflügelten Wort des Erfinders der Szenario-Technik im Kalten Krieg auszudrücken – zum „thinking the unthinkable“ (Herman Kahn) anregt.
Dies ist die Ausgangsbedingung für ein Denken in Szenarien, denn die Prognose hält entlang des statistisch berechenbaren Durchschnitts keine ausreichenden Handlungsableitungen bereit. Ein angemessener Zugriff auf die Zukunft ist dann zu gewinnen, wenn sie als Möglichkeit gesponnen wird. Um sicherzugehen, wird also eine neue Zeitrechnung eingeführt: Man bezieht sich auf diffuse, also sich räumlich, zeitlich, sozial usw. nur vage abzeichnende Zukünfte. Auch wenn das Denken in Szenarien damit als fiktional zu charakterisieren ist, so ist das so Erdachte dennoch als unmittelbar existent zu handhaben, da es zu einer sozialen Tatsache wird, mit der zu rechnen ist. Durch seine bloße Existenz entfaltet das Szenario Evidenz; es ist performativ.
Besondere Prominenz nimmt im Corona-Diskurs das worst case Szenario ein. Es orientiert sich an absoluten Krisenfiktionen, an einer Lesart der Pandemie als einem alles verändernden, schrecklichen Ereignis. Das Eintreten des worst case bedeutet immer einen traumatischen Verlust, angefangen bei der Zerstörung bestehender politischer und wirtschaftlicher Ordnungen bis hin zur Vernichtung zentraler Ressourcen. Im worst case kommt das Virus als absolute Gefahr daher. Nach einer vom Innenministerium in Auftrag gegebenen Studie werden verschiedene worst case-Szenarien hinsichtlich unterschiedlicher Grade staatlichen Eingreifens gesponnen. Im Fall nur geringer staatlicher Restriktionen, wenn etwa nur größere Veranstaltungen verboten und Reisetätigkeiten eingeschränkt würden, geht man etwa davon aus, das bis zu 350.000 Menschen gleichzeitig intensivmedizinische Versorgung benötigen würden, „was angesichts der vorhandenen Kapazitäten bedeuten würde, dass 85 Prozent derjenigen, die sie brauchen, abgewiesen werden müssten“[1].
***
Weil das Denken in worst case-Szenarien eine eigentümliche Evidenz entfaltet, wird es anfällig für die Rhetorik des Sachzwangs; in seiner augenscheinlichen Plausibilität setzt es einen notwendigen Handlungsgrund. Das reduziert derzeit eine ganze Reihe der üblichen Rechtfertigungszwänge demokratischer Politikroutinen. Ausreichend erscheinen Begründungen auf der Ebene des Epidemologischen, die Politik zu einem bloßen Verlautbarungsinstrument degradieren. Philipp Sarasin bemerkt dazu ironisch, alles wirke „wie ein biopolitischer Traum: Von Ärzten beratene Regierungen zwingen ganze Bevölkerungen unter eine Seuchendiktatur, entledigen sich unter dem Titel der ‚Gesundheit‘, ja des ‚Überlebens‘ aller demokratischen Hindernisse“[2]. Entsprechend sind eventuelle Berechnungen des möglichen Schadens, der durch die politischen Maßnahmen entsteht, ebenso wie politische Langzeiteffekte erst einmal nachrangig und werden erst im Verlauf – wiederum durch Szenarien – erhoben.[3] Auch die Wirksamkeit der unterschiedlichen gesetzten Maßnahmen darf im Spekulativen verbleiben.
In diesem Sinne ermöglicht es der worst case nicht nur, das volle Register des Infektionsschutzgesetzes in Gang zu setzen, sondern (man denke an die allgemeine Ausgangsbeschränkung) weit darüber hinauszugehen.[4] Er ermöglicht weiter eine im „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ geregelte, verfassungsgesetzlich bedenkliche Novellierung, die dem Bundesgesundheitsminister beispiellose Vollmachten erteilt.[5]
Im Rückgriff auf den worst case und damit zusammenhängend auf die Installierung weitreichender präventiver Maßnahmen bedient sich die Politik damit einer etablierten Krisentechnologie: Als besondere abwehrrechtliche Maßnahme, die gesetzt wird, um dem drohenden Verlust zu entgehen, ähnelt die gesetzte Strategie beispielsweise dem ursprünglich militärischen Prinzip der Präemption. Dieses berechtigte einen Staat nach internationalem Recht zur Durchführung eines Präventivschlags, wenn ihm Beweise oder Warnungen über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff vorlagen. Heute hat sich diese Bedeutung ins Innere verschoben; sie hat sich zu einer zivilen Technik unter militärischen Vorzeichen gewandelt. In der Kriminalpolitik kommt Präemption gefahrenabwehrrechtlich im „Krieg gegen den Terror“ zum Einsatz. Hier wie dort begründen worst case-Szenarien weit in die Zukunft reichende Vorgriffe auf Gefahren. Es überrascht deshalb nicht, dass in vielen Ländern derzeit kriegerische Terminologien kursieren. Man muss nur nach Frankreich schauen, um zu erkennen, dass hier ein „Krieg gegen das Virus“ geführt wird.
Der worst case legitimiert mithin unter breiter gesellschaftlicher Zustimmung weitgehende Grundrechtseinschränkungen und bringt neue Strukturen der Ausnahme hervor. [6] Damit ist es weniger die aktuelle Lage als die Vorstellung des schlimmsten Falls, die zu den aktuellen Maßnahmen anreizt: Es ist das Denken in bestimmten Termini des Zukünftigen.
Fußnoten
[1] https://taz.de/Strategiepapier-des-Innenministeriums/!5675014/
[2] https://geschichtedergegenwart.ch/mit-foucault-die-pandemie-verstehen/
[3] Z.B. https://twitter.com/EconPolEurope/status/1244545057287548930/photo/1
[4] https://www.juwiss.de/27-2020/ und https://verfassungsblog.de/whatever-it-takes/
[5] https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/181/1918111.pdf; https://verfassungsblog.de/parlamentarische-selbstentmaechtigung-im-zeichen-des-virus/
[6] Vgl. hierzu umfassend https://www.cilip.de/institut/corona-tagebuch/?fbclid=IwAR3lUg5JSzZjNwyF2ldEYzQk0ZawbkBVd-kKCXe-bNx4YFUuvJSiO0HvFOQ
État d’urgence sanitaire : les quartiers populaires sous pression policière
Le présent article a été publié en mai 2020 dans l’édition spéciale de la revue De facto (Institut Convergences Migrations) sur les inégalités ethno-raciales dans la crise du coronavirus.
Jérémie Gauthier
Spécialisé dans les questions policières et les politiques de sécurité, Jérémie Gauthier est Maître de conférences en sociologie à l'Université de Strasbourg et chercheur au laboratoire Dynamiques européennes. Depuis 2007, il est également associé au Centre Marc Bloch où il a participé à différentes recherches dont le projet franco-allemand CODISP « Developing local security intelligence in German and French police forces – Bringing together two knowledge cultures » financé par l'ANR et le BMBF entre 2012 et 2015. Parmi ses publications, plusieurs ont été réalisées en coopération avec d’autres chercheur.e.s du Centre Marc Bloch, comme par exemple l'ouvrage Police. Questions sensibles, codirigé avec Fabien Jobard et paru aux Presses universitaires de France en 2018.
Avec l’instauration du confinement et de l’état d’urgence sanitaire, l’accès à l’espace public a été considérablement restreint. Mais son contrôle, assuré par la police et la gendarmerie, renforce les traitements discriminatoires et racistes vis-à-vis des populations les plus pauvres.
La crise provoquée par l’épidémie de coronavirus fait ressortir avec éclat la gestion policière des quartiers populaires et ses conséquences pour leurs habitants. Les mesures de confinement puis l’état d’urgence sanitaire adopté le 24 mars 2020 ont en effet profondément reconfiguré l’accès des personnes à l’espace public, notamment par la mise en place d’une restriction des déplacements, l’une des plus sévères d’Europe occidentale. Sur l’ensemble du territoire, la police et la gendarmerie se sont donc vues assigner une mission de contrôle resserré de l’espace public et de la circulation des personnes, reposant sur les désormais fameuses « attestations dérogatoires de déplacement ».
Depuis la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, le volume des contrôles des déplacements réalisés par les forces de l’ordre ainsi que le nombre d’amendes infligées par ces dernières font partie des indicateurs qui, aux yeux de l’équipe gouvernementale, témoignent de la réussite de leur action. Fait inédit en matière de contrôles policiers, le ministère de l’Intérieur communique depuis la fin du mois de mars les statistiques relatives au nombre de contrôles effectués et sur les amendes pour « non-respect du confinement » auxquelles ils ont donné lieu. Le 23 avril 2020, Christophe Castaner déclarait que « 15,5 millions de contrôles ont été faits depuis le début du confinement sur l’ensemble du territoire et 915 000 procès-verbaux dressés ». Cet autosatisfecit passe sous silence d’importantes inégalités territoriales, tant dans le nombre de contrôles conduits que dans les modes d’intervention de la police.
Bien que lacunaires, les données et informations disponibles indiquent en effet que les zones urbaines paupérisées, où réside une proportion importante de personnes racisées, concentrent non seulement la majorité des contrôles, mais aussi des faits de brutalité et de racisme policiers. En matière de police, le contrôle des déplacements et des activités mis en place dans le contexte de l’épidémie vient ainsi renforcer des dynamiques de discrimination et de violence déjà à l’œuvre depuis des décennies dans les espaces urbains les plus pauvres.
Contrôles, contraventions, couvre-feux
À la différence des contrôles d’identité conduits dans le cadre de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, les contrôles des déplacements pendant l’état d’urgence sanitaire font l’objet d’un comptage statistique rendu public lors des points presse du ministère de l’Intérieur. Il n’a fallu que quelques jours pour voir émerger de fortes disparités dans le volume des contrôles et des amendes en fonction des territoires. La Seine-Saint-Denis, par exemple, n’est pas seulement « le département plus pauvre de France », il affiche qui plus est une des plus importantes surmortalités liées au virus ainsi que le taux de verbalisation le plus élevé en Île-de-France : dès la première journée de mise en place des contrôles, le département a totalisé 10 % des PV dressés sur l’ensemble du territoire français, d’après la procureure de la République de Bobigny.
Fin avril, les chiffres fournis par le ministre de l’Intérieur indiquent un taux de verbalisation d’environ 6% à l’échelle nationale. Si, à Paris (6,3%), ce taux est légèrement supérieur à la moyenne nationale, c’est surtout dans les départements d’Île-de-France, les plus densément peuplés, qu’il explose : 8,7% dans les Hauts-de-Seine, 13,7% dans le Val-de-Marne et 17% en Seine-Saint-Denis où le taux de verbalisation frôle le triple de la moyenne nationale. Les chiffres révèlent donc une disproportion dans la distribution des contraventions au sein d’un département où réside une population pauvre, racisée et dont les relations avec la police sont, depuis des décennies, marquées par de très fortes tensions.
Par ailleurs, aux mesures évoquées précédemment est venue s’ajouter l’instauration de couvre-feux dans un peu moins de deux-cent communes, principalement dans le sud-est et le nord de la métropole ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et en Polynésie française. Fin mars, environ deux millions de Français étaient concernés par ce type de mesures. Destiné à empêcher la fréquentation des plages et des espaces touristiques, le couvre-feu a parfois été appliqué plus sévèrement dans certaines zones urbaines : c’est le cas par exemple à Nice où, dans les quartiers populaires, la mesure doit être respectée à partir de 20h, contre 22h dans les autres quartiers.
En matière de police, le contrôle des déplacements et des activités mis en place dans le contexte de l’épidémie vient ainsi renforcer des dynamiques de discrimination et de violence déjà à l’œuvre depuis des décennies dans les espaces urbains les plus pauvres.
Ce premier constat appelle trois remarques. Tout d’abord, on soulignera que l’imprécision (qu’est-ce qu’un « achat de première nécessité » ?) et la fragilité juridique des mesures de contrôle et de verbalisation (notamment concernant la réitération) mises en place depuis le début de l’épidémie renforcent le pouvoir discrétionnaire des agents de terrain. Or ce pouvoir en matière de contrôles, déjà très important en France, a été identifié comme une des causes principales des abus et des discriminations[1]. Ensuite, concernant les contraventions, celles-ci viennent renforcer un phénomène mis en lumière par une recherche récente de la sociologue et juriste Aline Daillère, qui montre que les policiers utilisent depuis quelques années de manière croissante leur « pouvoir de verbalisation » pour sanctionner des adolescents et des jeunes adultes des quartiers populaires[2].
Enfin, la rapidité et l’efficacité avec laquelle a été mis en place un instrument d’enregistrement statistique des contrôles des limitations des déplacements dans le cadre de l’épidémie pourrait servir d’argument à celles et ceux qui demandent que les contrôles d’identité menés dans le cadre de l’article 78-2 du Code de procédure pénale fassent eux aussi l’objet d’évaluations chiffrées. En effet, bien que les biais (notamment raciaux) sur lesquels reposent ces contrôles aient été démontrés depuis une dizaine d’années par des enquêtes de terrain et un rapport du Défenseur des droits, le ministère de l’Intérieur refuse toujours de mettre en place un système de mesure tel que celui adopté par exemple au Royaume-Uni.
Violences, racisme, feux d’artifice
Des cas d’abus et de brutalités policières, dont une majorité ayant eu lieu dans des quartiers de banlieue, ont été signalés sur les réseaux sociaux dès la mise en place des mesures de confinement, à partir d’enregistrements vidéo ou des témoignages de victimes et/ou témoins. Ainsi, depuis quelques années, la police n’a plus le monopole du récit et de l’information sur les faits de brutalité. Depuis le début du confinement, ces derniers se caractérisent à la fois par leur similitude avec les violences qui ont émaillé l’histoire des quartiers populaires au cours des dernières décennies, et par l’augmentation de leur fréquence.
La régulation de l’espace public par le biais des contrôles policiers récurrents est une histoire ancienne dans les quartiers populaires et singularise le rapport de leurs habitants à la police, par rapport au reste de la population française. Le contrôle des déplacements et des populations dans le cadre du confinement est venu renforcer la spécificité de ces espaces où, par ailleurs, l’accès à l’espace public est souvent déterminant afin de pallier les difficultés liées aux conditions de vie. Sans surprise, la multiplication des contrôles réalisés dans le cadre du confinement a amplifié les problèmes déjà connus liés aux contrôles d’identité pédestres.
Dès le 17 mars, des témoignages et des signalements sont postés sur les réseaux sociaux rapportant une forte pression policière sur les quartiers de banlieue, des contrôles nombreux et parfois accompagnés de tensions verbales et physiques. Entre le 18 mars et le 6 mai 2020, le journaliste David Dufresne recense 24 signalements concernant des faits de verbalisations abusives ou de brutalités policières : insultes, coups de poings, de pieds et de matraque, usage de gaz lacrymogène, tir de taser et techniques d’immobilisation. Le 8 avril, un homme de 34 ans décède dans un commissariat de Béziers après son interpellation pendant le couvre-feu, et vraisemblablement après avoir fait l’objet de « techniques d’immobilisation » qui ont déjà provoqué la mort de plusieurs personnes par le passé, dont Wissam El-Yamni à Clermont-Ferrand en 2011, Adama Traoré à Persan en 2016 et, plus récemment, Cédric Chouviat à Paris début 2020. Par ailleurs, certains témoignages font état d’injures racistes : ainsi par exemple la vidéo tournée dans la nuit du 25 au 26 avril sur l’Île-Saint-Denis, où l’on voit des policiers qualifier de « bicot », une insulte issue du vocabulaire colonial, un homme qu’ils viennent de repêcher dans la Seine, avant qu’on entende des bruits de coups et des cris.
La mise en place des mesures de confinement s’est accompagnée quasi immédiatement d’une suspicion à l’égard des quartiers populaires, révélant un processus de racialisation des jugements d’indiscipline et d’incivisme.
Les brutalités policières ont également concerné des femmes, habituellement minoritaires parmi les personnes contrôlées et les victimes de ces brutalités. Le 19 mars, à Aubervilliers, un riverain filme le contrôle d’une jeune femme noire de 19 ans envers laquelle un groupe de policier s’adonne à une véritable « cérémonie de dégradation » : insultes sexistes, coups de matraque et tir de taser. Le 4 avril, dans le quartier de la Noé, à Chanteloup-les-Vignes, les policiers qui tentaient d’interpeller un jeune homme circulant en moto se sont vus opposer la résistance d’une partie des habitants. Au cours des échauffourées, les policiers procèdent à 14 tirs de LBD et de 9 lancers de grenades. Un de ces projectiles atteint à la tête une fillette de 5 ans qui sera ensuite transférée en réanimation à l’hôpital Necker à Paris.
Depuis le début du confinement, on peut distinguer trois périodes dont l’enchaînement traduit un crescendo dans les violences imputables aux forces de l’ordre, dans les réponses qu’elles ont suscitées au sein des quartiers populaires et dans la réaction politique. La première période, de mi-mars à début avril, voit se succéder un ensemble de faits qui ont été portés à la connaissance du public sur les réseaux sociaux mais qui n’ont pas provoqué de réaction collective au sein des quartiers où ils se sont déroulés.
Les évènements de Chanteloup-les-Vignes préfigurent quant à eux la deuxième phase, caractérisée par une intensification du cycle de la violence à partir du 18 avril, après qu’un homme de trente ans circulant en motocross a été grièvement blessé à la jambe suite à une collision provoquée par l’ouverture d’une portière d’un véhicule de police à Villeneuve-la-Garenne. L’incident, et l’extrême rapidité de sa médiatisation sur les réseaux sociaux, ont entraîné plusieurs nuits d’échauffourées dans différentes communes de France. Si ce contentieux trouve ses racines bien en amont du confinement, le fait que ces réactions collectives aient principalement et simultanément pris la forme de tirs de feux d’artifices en direction des forces de police poursuit également une stratégie de mise en visibilité. Les images saisissantes ainsi produites sont en effet particulièrement adaptées à leur diffusion sur les réseaux sociaux tout en s’inscrivant dans une tradition émeutière de certains quartiers de banlieue au moment du réveillon (à Strasbourg par exemple) et en présentant un simulacre guerrier : on entend ainsi le bruit des balles, sans qu’aucune arme à feu ne soit utilisée.
Enfin, et c’est la troisième phase, on a vu apparaître quelques fissures dans le mur du déni politique et policier suite aux craintes de généralisation des révoltes ainsi qu’en raison de l’émotion suscitée par l’injure raciste proférée sur l’Île-Saint-Denis. Cette multiplication des « croche-pieds à l’éthique », pour reprendre l’euphémisme utilisé par le ministre de l’Intérieur le 13 janvier dernier à l’occasion d’une des rares prises de parole politiques sur les brutalités policières, a conduit ce dernier à parler sur Twitter d’« indignation légitime » et à préciser que « le racisme n’a pas sa place dans la police républicaine ». Le Préfet de police de Paris demande quant à lui la « suspension » des agents mis en cause. Toutefois, comme souvent, on peut s’attendre à ce que la sanction de quelques agents permette de faire l’économie d’une réflexion critique approfondie du fonctionnement de l’appareil policier dans les zones urbaines paupérisées. Cette réflexion, déjà nécessaire avant le confinement, n’en sera que plus indispensable à l’issue de la crise sanitaire.
Violences systématisées, récits médiatisés
La mise en place des mesures de confinement s’est accompagnée quasi immédiatement d’une suspicion d’indiscipline et d’incivisme à l’égard des habitants des quartiers populaires mêlant préjugés sociaux et raciaux. Tandis que se trouvaient mis en lumière les écarts produits par les inégalités sociales et économiques dans l’expérience du confinement, ce dernier n’a pourtant été ni plus ni moins respecté en banlieue qu’ailleurs, comme l’a reconnu le préfet de Seine-Saint-Denis lui-même.
La gestion policière des quartiers populaires et de leurs habitants pendant la pandémie s’inscrit quant à elle dans la continuité de ce qui empoisonne la vie démocratique française depuis des décennies, sans équivalent dans les pays d’Europe occidentale. Modes d’intervention hasardeux, usage disproportionné de la force, affranchissement des règles de déontologie, surcontrôle, racisme : les faits sont trop nombreux pour qu’ils ne fassent pas « système ». D’autant que l’épidémie intervient après plusieurs mois d’une répression policière et judiciaire, sans précédent dans l’histoire récente, des mouvements sociaux des « Gilets jaunes » et de la contestation de la réforme des retraites.
Si la dynamique des violences reste habituelle (contrôles, violences, racisme, réaction collective des jeunes habitants dirigée contre la police), l’évolution majeure durant ces dernières années tient avant tout à la médiatisation des images par le biais des réseaux sociaux : la violence sort ainsi des espaces marginalisés dans lesquelles elle s’exerce la plupart du temps et la police perd le monopole de leur mise en récit. Certes, un recul critique est nécessaire pour appréhender les images (à ce sujet, voir l’analyse d’André Gunthert). Mais ce bouleversement majeur du champ médiatique contribue au désenclavement des quartiers de banlieue par la mise en visibilité du scandale démocratique que constitue la récurrence des brutalités policières, des discriminations, des expressions décomplexées de racisme de la part d’agents de l’État, du déni politique dont elle fait l’objet et que les lois d’état d’urgence ne font que conforter.
Notes
[1] Jérémie Gauthier, « Un art français de la déviance policière », in Gauthier, Jérémie et Jobard, Fabien (dir.), Police. Questions sensibles, Paris, Presses Universitaires de France, 2018, p. 51-64.
[2] Aline Dallière, « La justice dans la rue. Du pouvoir contraventionnel des policiers », Mémoire de Master 2 de Science politique, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2019.
Pour aller plus loin
Mogniss H. Abdallah, Rengainez, on arrive ! Chroniques des luttes contre les crimes racistes ou sécuritaires des années 1970 à nos jours, Paris, Libertalia, 2012.
Jérémie Gauthier et Fabien Jobard, Police. Questions sensibles, Paris, Presses Universitaires de France, 2018.
Fabien Jobard et Jacques de Maillard, Sociologie de la police. Politiques, organisation, réforme, Paris, Armand Colin, coll. « U Sociologie », 2015.
Sebastian Roché, Confiance et consentement sont au cœur de la maîtrise du coronavirus, Note de synthèse Terranova, 22 avril 2020.
What crisis? Corona as a socio-ecological shock
First published 23 April 2020 on the website of the Centre Marc Bloch
Judith Nora Hardt
Judith Nora Hardt holds a degree in International Relations, International Law and Legal History. She is conducting a postdoctoral research project at the Centre Marc Bloch on the ecological challenges of the globalisation of the European Union. In addition to her work at the CMB, she is coordinating the project "Climate change in security perceptions, conceptions and practice at the United Nations Security Council" in cooperation with the Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg. She is involved in the research group Climate Change and Security (CLISEC) at the University of Hamburg and is active in the Scientists for Future initiative.
As the corona-pandemic hits, the world shivers. Labeled a “symmetric shock” and “natural catastrophe”[1], corona marks a historical moment and a caesura. Here, I argue that this socio-ecological shock accentuates certain frictions and I elaborate on these implications by bringing the corona-pandemic and its respective health security measures in relation with other socio-ecological crises, often reduced to the phenomena of climate change.
Before corona, climate change was one of the top priorities in civil society, in the media and for several political leaders. Worldwide school strikes initiated by the Fridays For Future (FFF) movements in autumn 2018, and other protests demanded immediate necessary urgent measures to engage in a socio-ecological transformation and thereby ensure the(ir) futures. In reaction to multiple denigrations of claims made by FFF, a Statement[2], signed by more than 26.000 scientists, brought to life the grassroots initiative Scientist for Future (S4F) and highlighted the scientific foundations that underpin FFF concerns. S4F furthermore aims to stand up to the scholarly responsibility and communicate the threatening current situation and the necessity for urgent socio-ecological transformation.[3] Next to the prominent reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change that diagnose the alarming state of the warming climate, the community of Earth Systems Sciences describes the state of Planet Earth as being located on a trajectory towards a Hothouse Earth[4]. If this trajectory is not corrected towards a Stabilized Earth by urgent measures, scientists warn of the risk of passing global tipping points, which will lead to “serious disruptions to ecosystems, society, and economics”[5] and therefore imply “an existential threat to civilization”[6].
The declaration of the state of climate emergency by the European Commission in November 2019[7], as along with the instauration of citizen assemblies, and the several debates in the United Nations Security Council on the massive implications of climate change on peace, conflict, and security[8] only provide some prominent examples of how the threatening dimensions and the need for effective and urgent measures have been partly recognized in politics. In 2019, and before corona, the UN-Secretary General stated “Let us not mince words: the climate crisis is a race against time for the survival of our civilization, a race that we are losing.”[9] Appropriate measures that would correspond to a crisis[10] are however yet to come and next to institutionalized scientific channels, several networks of scientists are raising their voice in the face of the dramatic foreseeable threats[11].
Yet, with the outbreak of the worldwide pandemic and the dramatic increase in deaths at the turn of 2019-2020 drastic emergency measures of unknown and unpredictable consequences for society, politics, economy and security have been taken. The health security measures include among others immediate forced paralysis through a generalized shutdown and quarantine. The corona-crisis is also marked by fear, the previsions of multiple follow-up conflicts[12], war declarations on Covid-19[13], calls for global ceasefire and peace[14], massive economic losses and aid packages, an erosion of multilateralism and international institutions[15], and accentuates a return to closed borders and nation state principles in the attempt to isolate. Thereby these so-called measures of crisis management comply with the characteristics of classical security policy focused on the state, territory, military, violence, and power and with the broader definition of security, being centrally composed by “existential threats, emergency action, and effects on inter-unit relations by breaking free of rules”[16]. In accordance with security logics, this watershed moment of fighting against the invisible threat and the emergent protective security measures overrule every other issue. The socio-ecologic shock literally paralyses everything as its direct impacts and the immediate foreseeable consequences grow. Meanwhile planet Earth continuous to “err on the side of danger”[17].
The caricature placed in the title positions the corona-crisis in relation to climate change. It thereby accentuates several debates[18] and central interrelated challenges – here called “frictions”.
A first friction contains the acknowledgment of the multiple existential crises we are in. In contrast to the World Risk Society, which describes the status of being at the steady brink of catastrophic risks[19], we are suddenly catapulted into what would have been some months ago described as a science fiction scenario. The second friction concerns the intertwined strong human-nature relations in the new geological era of the Anthropocene[20] and the embeddedness of humans as Earthly creatures.
A third friction becomes apparent as we bring the responses to the crises into focus. It especially highlights that the traditional understanding and measures of security policy, crisis management plans and actors do not solve nor measure up to the extents, nature and quality of the threats. Furthermore, the mono-oriented policies that deal with crises in a chronological linear order and the assumption of control, endpoints and solutions are further frictions that the corona-pandemic and the socio-ecological crises and Anthropocene bring into light. In addition, the complexity of the several interconnected, simultaneous and massive crises highlight the political nature and choice of how and which topic is dealt with in which sector and with what focus. Another friction comes to light in the question of which are correct preventive measures, as they will only be qualified as such a posteriori in the absence of a catastrophe.
A major friction rests at the interfaces between science, civil society and politics, such as the relation between sciences, disciplines, and the general communication of the sciences. By the beginning of April 2020, there has been only one major reaction from a broader community of scientists – the call from the Club of Rome “Climate-Planetary Emergency”[21] addressed to global decision-makers. However, the question of how to overcome the disciplinary, institutional and national borders and channels of science communication in the long term remains another challenge in the context of the several simultaneous crises. The sciences find themselves facing enormous tasks, especially given that they are supposed to describe the situation, evaluate what went wrong[22] and develop predictions and recommendations.
As the world moves forward, the necessity to re-evaluate the current situation, develop new knowledge and find ways and tools to “think the several crises” together, such as by engaging with how to grasp the categories of existential threats, trouble and values, constitute future research tasks and also calls for an improved communication of the sciences. The political and philosophical question of “how do we evaluate the different crises we are in” becomes central. The definition and measurements of the curve of – to borrow the word used in the above caricature – “trouble” becomes necessary. Do we, for example, measure “trouble” in the context of the multiple socio-ecological crises in terms of immediate deaths, increased violence, power abuse, social fraction and/or as economic losses? Does the focus lie on the Western, rich, poor, vulnerable societies or on the future generations to come? Is it about the erosion of the political systems, the possibility of the disruption of the contemporary world order and institutions or is it about the loss and degradation of common values of solidarity, support, freedom and intra- and intergenerational justice? Or do we measure “trouble” in terms of quality of life, of health or the likely event of a so-called tipping cascade into a Hothouse Earth?
This multiplicity of tasks that touch upon political, historical, psychological and philosophical questions and new emerging research will hopefully team up with the natural sciences, and the several emerging interdisciplinary and border-crossing networks of engaged scientists[23] might provide an important ground for developing ways to overcome several barriers. Within these new globalized, embedded, dynamic and complex crises of the Anthropocene, developing holistic approaches through the re-evaluation of the here and now is of upmost importance in order to be able to develop ways to deal with the multiple and simultaneous frictions, threats and shocks.
Notes
[1] Angela Merkel press statement, 6.4.2020,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=725&v=eFAgf3A58bc&feature=emb_logo
[2] https://www.scientists4future.org/stellungnahme/statement-text/
[3] “We see it as our social, ethical, and scholarly responsibility to state in no uncertain terms: Only if humanity acts quickly and resolutely can we limit global warming, halt the ongoing mass extinction of animal and plant species, and preserve the natural basis for the food supply and well-be-ing of present and future generations. This is what the young people want to achieve. They deserve our respect and full support” (Hagedorn et al. 2019, “The concerns of the young protesters are justified. A statement by Scientists for Future concerning the protests for more climate protection”, GAIA, 28(2): 79-87; 140).
[4] Steffen, W. et al. 2018. "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene". Proceedings of the Natural Academy of Sciences of the United States of America 115(33): 8252-8259.
[5] Ibid: 1.
[6] Lenton, T.M., Rockström, J. ; Gaffney, O., Rahmstorf, S., Richardson, K., Steffen, W. & Schellnhuber, H. J. 2019. "Climate tipping points—too risky to bet against". Nature, 575 (28): 592-595; 595.
[7] The European Parliament declares climate emergency Press Releases, 29-11-2019. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
[8] A fifth Arria Formula meeting is planned for 22 April 2020. https://www.whatsinblue.org/2020/04/arria-formula-meeting-on-climate-and-security-risks-the-latest-data.php
[9] https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-11-11/remarks-the-paris-peace-forum
[10] According to Greta Thunberg‘s (FFF) warning "We cannot solve the crisis without treating it as a crisis", Speech at the COP24 Plenary Session, Katowize (Poland), 2018, https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg
[11] Next to the S4F-Statement see also Ripple, W.J.; Wolf, C.; Newsome, T.M.; Barnard, P.; Moomaw, W.R. & 11.258 Signatories from 153 Countries. 2019. "World Scientists’ Warning of a Climate Emeregency". BioScience 1.
[12] See for example International Crisis Group, „COVID-19 and Conflict: Seven Trends to Watch“, 20 April 2020, https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
[13] See for example the French president's speech from 16 March 2020.
[14] UN Secretary-General António Guterres, https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/fury-virus-illustrates-folly-war
[15] “This is the fight of a generation and the raison d’être [reason for being] of the United Nations itself,” UN Secretary-General António Guterres, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/coronavirus-threat-to-global-peace-and-stability-un-chief-warns
[16] Buzan B., Wæver O. & De Wilde J. 1998. Security: A new framework for analysis. Boulder, London: Linnie Rienner Publishers: 26.
[17] Lenton et al. , op. cit. : 592-595. See also the Call of the Club of Rome initiated “Climate-Planetary Emergency”. https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/
[18] The possible severe or beneficial consequen- ces of the corona-crises for climate change and for climate politics continue to be discussed. While on one hand the corona-crisis have forced the postponement of the COP26 planned for November 2020 in Glasgow (UK), the crisis is also described as “an opportunity to end the war with nature“ (see e.g. Vishwas Satgar, April 2020, https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-25-covid-19-the-climate-crisis-and-lockdown-an-opportunity-to-end-the-war-with-nature/ ) or as the chance to successfully deal with the socio-ecological crises (“Was uns die Krisen lehrten“, John Schellnhuber, 16.4.20. FAZ, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/seuche-im-anthropozaen-die-lehren-der-corona-krise-16726494/allein-schaffen-wir-es-nicht-16726800.html).
[19] Beck, Ulrich. 2007. Weltrisikogesellschaft. Suhrkamp Verlag.
[20] Crutzen, P. 2002. "Geology of Mankind". Nature, 415(6867): 23–23; Rockström, J. et al. 2009. "Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity". Ecology and Society: 14 32.
[21] https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/
[22] See for example Bruno Latour, who describes the current situation as an opportunity for a re-evaluation and selection of the existential („Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise“, 30.3.20. https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/). See also Markus Gabriel, who argues for a new metaphyscial Pan-Demie and era of Enlightment („Wir brauchen eine metaphysische Pandemie“, 20.3.20, https://www.uni-bonn.de/neues/201ewir-brauchen-eine-metaphysische-pandemie201c).
[23] See for example S4F (https://www.scientists4future. org/), Enjust (http://www.enjust.uni-kiel.de/?lang=en), Environmental Peacebuilding Association (https://environmentalpeacebuilding.org/) and the Planetary Emergency Partnership (https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/).
L'Ukraine et sa double peine
Publié initialement le 25 mai 2020 sur le site du Centre Marc Bloch. Actualisé pour cette Newsletter
Sophie Lambroschini
Dr. Sophie Lambroschini, chercheure au Centre Marc Bloch, est spécialiste de la Russie et de l'Ukraine contemporaines. Associant histoire et sociologie économique, elle étudie les réseaux et acteurs économiques en temps de crise, notamment durant la Guerre Froide et la guerre actuelle dans le Donbas ukrainien.
13.000 morts, 31.000 blessés et de nouvelles victimes toutes les semaines : les combats violents aux marges de l'Union européenne ne font que rarement la « une » de nos médias. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, il est encore moins question de la guerre en Ukraine opposant depuis six ans des formations séparatistes soutenues par Moscou au gouvernement ukrainien dans l'est du pays. La pandémie aiguise, dans l'espace ukrainien dont la souveraineté et l'existence des populations sont déjà fragilisées, les problèmes existants. La société ukrainienne fait face à une double peine, sanitaire et sécuritaire, qui aggrave une situation économique et politique instable. Cet article propose une vue d'ensemble sur ces perspectives sociétales pour des populations vivant dans un espace d'entre-deux-crises politiques, réformes structurelles, et de conflit avec le voisin russe. Cet article explore aussi lien entre la spécificité de l'Ukraine et quelques perspectives plus globales.
Au 11 mai on dénombrait 408 décès liés à la Covid-19 avec 15.000 cas positifs (pour une population de 40 millions d'habitants), dans des foyers principalement à Kiev et dans l'ouest, basé sur les données d'un dépistage en hausse mais qui reste faible. La mise à l'épreuve de l'Ukraine par la pandémie de la Covid-19 est caractérisée par une crise sécuritaire qui bouleverse une société en phase délicate de mise en œuvre de réformes issues de la révolution du Maïdan. La difficulté pour l'Etat ukrainien à assurer l'accès aux services publics de soins mais aussi la fermeture des frontières qui limitent les envois de fond des travailleurs migrants soulignent sa vulnérabilité sociale et économique.
La crise sanitaire nourrit d'incertitudes cet « espace entre-deux », concept introduit par la géographe Violette Rey pour comprendre l'Europe médiane. L'entre-deux est caractérisé par la forte influence de forces exogènes sur ces espaces dont les populations, face aux crises multiples sont souvent obligées de « recommencer de zéro » qui génère aussi une créativité forte.[1]
Comment populations, élites, et pouvoirs publics agissent-ils alors dans ce contexte face à l’épidémie ? D’autres périodes de crise aiguë, comme la dernière fois au printemps 2014 lorsque les forces de libéralisation démocratique du Maïdan se heurtaient à l'ancien pouvoir, ont montré qu’elles sont propices à la montée en puissance de l'informel et de l'innovation, des stratégies d'adaptation engagées face à l'effondrement des ordres établis[2], tant parmi les populations cherchant à survivre que parmi les acteurs politiques. Depuis le mois d’avril, on constate une imbrication de l'action publique et privée, d'une dévolution de fait des responsabilités étatiques en matière de santé vers le secteur privé et citoyen, et le repli sur les réseaux et pratiques informelles. En même temps, la gestion institutionnelle de la crise sanitaire en Ukraine reflète celle des pays européens à travers les questionnements qu'elle soulève dans l'espace public sur le rôle de l'État social et la gouvernance locale.
Des mesures engagées en phase avec les politiques globales de lutte contre la pandémie et avec des spécificités
Les mesures prises par le gouvernement ukrainien suivent le protocole désormais assez généralisé de régime de confinement, de cordon sanitaire, et de mobilisation des acteurs publics et privés. Le 16 mars le président Volodymyr Oleksandrovych Zelensky intervient à la télévision pour annoncer des mesures de « quarantaine » suivi d'un régime de situation d'urgence : fermeture des commerces, des écoles jusqu'en septembre, suspension du trafic aérien hormis des vols de rapatriement, et le placement sous quatorzaine des arrivants isolés dans des sanatoriums ou hôtels. Conformément à la logique centralisée de l'Etat, un Conseil de coordination de lutte contre la propagation de la Covid-19 placé sous la tutelle du Président et la direction du directeur adjoint de l'Office présidentiel réunit les ministres clefs, et supervise un fonds dédié sur la base d'une ré-allocation des rentrées budgétaires. Par ailleurs, des réunions ad hoc pilotées par la présidence en visioconférences réunissent les maires et gouverneurs, eux-mêmes à la tête de conseils locaux. D’autres réunions organisées sous l’égide présidentielle regroupent les représentants des grandes entreprises ukrainiennes, ou encore les acteurs internationaux. La voix des organisations internationales, déjà présentes préalablement car invitées à accompagner les réformes et la gestion de la crise humanitaire dans la région du conflit en Ukraine orientale, y est forte avec des représentants permanents du CDC américain, de l'OMS, et d'organisations non-gouvernementales internationales. Au cours des mois de mars et avril, le gouvernement ukrainien s'est cependant progressivement distancé de certaines directives de l'OMS pour introduire des mesures plus souples reflétant les réalités socio-économiques et la faiblesse du système de sécurité sociale, comme la réouverture des commerces sous pression par le bas – populations et municipalités autrement laissées sans ressources. Une réouverture des lieux publics (marchés, centres commerciaux, théâtres, certaines terrasses de cafés etc.) a désormais lieu, différenciée en fonction des taux d'infection locaux – c’est la « quarantaine adaptative ». Dans certaines localités comme Kiev et en province (par exemple Kakhovka et Mykolaiv, au sud du pays) ont introduit des contrôles sous forme de check-points militaires qui rappellent en apparence ceux, spontanés, durant les mois d'instabilité de 2014 au lendemain de la prise de la Crimée par la Russie.
En Ukraine orientale, dans la zone du conflit du Donbas, et au sud sur la ligne de séparation administrative avec la Crimée annexée par la Russie, la crise sanitaire se heurte aux limites de la souveraineté : les territoires échappant au contrôle du gouvernement ukrainien constituent un « trou noir » sanitaire, les informations sont éparses, un régime de contrôle interdit les passages quotidiens entre les deux zones, isolant ainsi les Ukrainiens vivant de « l’autre côté ». Aux abords de la ligne de contact dans le Donbas, les systèmes de santé et de services de réanimation et d'infectiologie demeurent en sous-effectif sévère (40%), et près d'un tiers des établissements de soins ont des problems d'accès à l'eau.
L’accès aux soins proches de la ligne de front et dans les territoires séparatistes apparaît particulièrement critique, mais aussi dans le reste du pays les différences régionales sont importantes, compensées en partie seulement par les dons privés et les initiatives citoyennes (souvent nées dans le contexte de la guerre et réorientés sur des objectifs sanitaires) pour les équipements de protection et de soins[3]. On constate d'ailleurs un taux d'infection du personnel hospitalier qui atteint 25% par endroit. Les appels issus du pouvoir et de la société civile pour mobiliser contre la propagation du virus puisent d'ailleurs parfois dans la symbolique des mobilisations civiques de ces dernières années.
Les réformes de la santé et du pouvoir local suspendues dans un contexte de crise sanitaire
L'urgence de la gestion de la pandémie coïncide avec la mise en œuvre de deux réformes fondamentales pour libéraliser le système public ukrainien : une réforme du système de santé, et une réforme de l'administration étatique par une décentralisation financière et politique vers les municipalités. Les deux réformes sont difficiles à mettre en œuvre car elles se heurtent à des résistances : elles sont mises en place progressivement, « au fil de l'eau », interrompues par des étapes de négociation entre les acteurs politiques et économiques aux intérêts divers et divergeants. Or, l'urgence de la pandémie bouleverse ces processus en cours d’élaboration.
Le système de santé ukrainien non-réformé suivait le modèle soviétique de gratuité tout en dépendant de fait de pratiques opaques et informelles palliant le sous-financement chronique et nourrissant les réseaux de corruption. Sa réforme était l'une des revendications sociales de la révolution du Maïdan. La réforme du système de santé engagée depuis, vise un modèle de transparence, de financement par le budget de l'État et par l'assurance privée avec une mise en concurrence des hôpitaux pour les financements publics gérés par un Service national de la santé. La réforme a eu pour but immédiat de passer à une gestion centralisée des commandes de médicaments et équipements afin de briser les réseaux de corruption et de détournement de fonds publics dans le secteur. Mais elle est prise en tenailles entre une logique néolibérale de rationalisation de l'offre et le défi d'une prise en charge équitable. Après une étape initiale où le système de commandes avait été mise sous tutelle internationale, la réforme a été engagée progressivement durant deux ans. Elle avance par à-coups, se heurtant à de fortes résistances politiques et économiques. Les objectifs de cette transformation sont entrés en conflit avec les priorités de l'urgence sanitaire posée par la pandémie d'équiper au plus vite les hôpitaux. Déjà les médias et organisations d'investigation ukrainiens, notamment l'initiative de contrôle citoyen Dozorro, ont constaté le recours à des circuits d'approvisionnement opaques avec des prestataires douteux, contournant les procédures au nom de l'efficacité dans l’urgence.
La réforme de l'État centralisé ukrainien a pour principe la décentralisation par une promotion de l'auto-administration municipale. La décentralisation consiste principalement à renforcer la démocratie locale par la décentralisation de certains revenus fiscaux et les compétences qui y sont associées pour renforcer les collectivités locales. Les mairies seraient ainsi en mesure d’ agir au plus près des populations mais aussi comme contre-pouvoir aux clans politico-économiques à l'ancrage régional. Cependant, les élections locales prévues au printemps qui devaient légitimer et ancrer les pouvoirs locaux ont été reportées en raison de la crise sanitaire.
Or, la décentralisation n'est pas une question neutre car elle touche aux débats autour de la souveraineté et attise l’inquiétude face au risque de forces centrifuges à l’est. Déjà tendues par la perte de territoires à l'est en Crimée, la réforme du pouvoir local se heurte à la répartition des compétences entre centre et région pour gérer la propagation de l'épidémie. Cette tension se reflète sur fond de crise sanitaire dans les revendications de l'association des maires, sorte de lobby des petites collectivités face aux gouverneurs et au gouvernement. Les maires y soulignent que la décentralisation est suspendue dans un stade intermédiaire, où les modes de gestion ancienne et nouvelle s’entrechoquent : les municipalités sont chargées de responsabilités nouvelles mais démunies financièrement. La décision début mai du maire de Tcherkassy, ville des régions centrales agricoles de la rive droite du Dniepr où le virus semble peu circuler, de lever unilatéralement le confinement en contravention de l'ordre gouvernemental, a réveillé les peurs traditionnelles en Ukraine que toute désolidarisation avec le centre pourrait servir de brèche aux promoteurs d'une « fédéralisation » appuyée par la Russie.
Crise sanitaire et crise économique, le poids des acteurs oligarchiques régionaux
Les difficultés socio-économiques accumulées depuis la sortie du communisme et la guerre sont exacerbées par la crise sanitaire. Les pertes d'emplois couplées avec un système d'assurance chômage faible signifie qu'une partie importante de la population active vit dans une économie de subsistance. Selon un sondage réalisé fin mars, plus de la moitié des sondés estimaient ne disposer que d'« économies pour quinze jours ». Ainsi, la pression économique et sociale sur le gouvernement pour un confinement souple est forte. De surcroît, la généralisation de l'arrêt des activités dans l'ensemble de l'Europe et en Russie prive l'Ukraine des « remittances », ces transferts de fonds de ses travailleurs migrants ukrainiens. Le PNB par habitant en Ukraine est estimé, selon la Banque mondiale, à 38.00 dollars US en 2018, avec plus de 11% de la richesse nationale générée par les envois de fonds des Ukrainiens travailleurs migrants en Russie ou en Union européenne, eux-aussi happés par la crise.
Pour faire face à cette impuissance de l'État central, le gouvernement disposera de ressources supplémentaires internationales (comme un futur prêt stand-by Covid-19 du FMI) mais les ressources publiques sont insuffisantes pour faire face aux besoins. La mobilisation privée de ressources, sous forme d'initiatives citoyennes, humanitaires internationales, ainsi que des milieux d’affaires, prend la relève d’un État faible. La mobilisation des grandes fortunes ukrainiennes en temps de crise constitue d'ailleurs une pratique d'adaptation déjà éprouvées par le passé. La spécificité du système politique et économique ukrainien est l'arrangement complexe entre un pouvoir très centralisé et des clans politico-économiques ancrés régionalement. Ainsi, les fortunes des hommes d'affaires influents qui disposent de relais politiques au parlement, au sein de l'exécutif et chez les gouverneurs – souvent qualifiés pour cette raison d'« oligarchiques » – sont établies suivant une logique d'influence régionale héritées des spécialisations de l'époque soviétique (agriculture au centre, métallurgie et charbon à l'est…).
Élu sur une plateforme de pacification mais aussi de modernisation démocratique dans un paysage encore dominé par des acteurs oligarchiques, le président Zelensky se projette comme un arbitre entre ces forces. En mars il a ainsi appelé les principaux hommes d'affaires ukrainiens – ces mêmes clans économiques aux ancrages régionaux forts – à constituer une sorte de front économique solidaire face à la crise en suppléant aux besoins en équipement médical suivant une répartition géographique en fonction de leur influence économique par région. Les magnats de l'industrie et de l'agriculture semblent avoir été réactifs et efficaces dans la levée de fonds (et leur autopromotion) : importations de centaines de milliers de tests, d'équipements de protection et d'appareils de ventilation, des versements dans le fonds d'aide public de centaines de millions de hryvnias. Cependant la puissance politique et économique de ces groupes met en opposition et en concurrence les acteurs publics et privés, au risqué d'éroder la légitimité étatique : dans l'oblast' de Kharkiv, l'homme d'affaire Iaroslavski a créé un état-major de crise sanitaire qui double l'état-major officiel présidé par le gouverneur. Retransmise en ligne, la première réunion de cet état-major du « business », comprenant les patrons des principales entreprises de la région, projette le message d'un pouvoir local dominé par les capacités financières organisationnelles du privé sur le public, soulignant l'impuissance de l'État. Cette mise en concurrence entre pouvoir d'État et business rappelle les processus similaires de dévolution par l'État de ses compétences à des acteurs privés comme stratégie de gestion de crise au début de la guerre en Ukraine orientale en 2014. Certains clans régionaux, notamment dans les régions politiquement fragiles du sud et de l'est, avaient pallié la faiblesse régalienne en assurant la loyauté politique, l'ordre civique local et la stabilité économique mais aussi la formation et l'équipement de formations armées privées, la création d'états-majors parallèles à ceux de l'armée ukrainienne. Face à cette concurrence, le pouvoir central, à l'époque sous le contrôle de l'ex-président Petro Porochenko avait finalement réussi une reprise de contrôle sur les ressources du maintien de l'ordre et les flux financiers. Aujourd'hui, le président Zelensky doit donc imposer le pouvoir de l'État dans des conditions de crise multiple.
La crise sanitaire dans un contexte de guerre
Dès le début du conflit qui a coupé en deux le Donbas, une région industrielle intégrée et fortement urbanisée, les lignes de fractures géopolitiques s'étaient manifestées sur le terrain par un démembrement des circuits et réseaux sociaux, économiques et sanitaires pour au moins six millions d'Ukrainiens vivant dans la région. Elle a aussi fait éclater le tissu sanitaire et social préexistant, fragilisant une population âgée, un tiers de plus de 60 ans, car les hôpitaux sont inaccessibles ou endommagés. La réception des pensions de retraite est difficile pour 30.0000 retraités et leurs dépendants vivant en zone séparatiste, les réseaux de distribution d'eau et de chauffage sont détruits sous les tirs d'obus, les circuits d'approvisionnement de médicaments coupés. Pour atténuer et contourner ces problèmes, les populations et les entreprises se sont adaptées souvent de manière informelle et avec l'aide de mobilisations issues de la société civile, des ONG internationales et Organisations internationales (ONU), et des programme d'aide au développement de différents pays. Or les mesures contre la pandémie menace ce mode de fonctionnement : la mise en place d'un système restrictif du passage de la ligne de démarcation empêche le retrait des pensions de retraites, l'accès aux soins, les coupures d'eau rendent impossibles le respect des conditions sanitaires. Ces entraves à une liberté relative de circulation menacent de creuser l'isolement et de dégrader des conditions économiques précaires, comme le rappelle une vague de fermeture d'une douzaine de mines du côté séparatiste en République populaire de Lougansk. Les conséquences de la pandémie du côté séparatiste (comme en Crimée sous contrôle russe) sont difficiles à établir. Non reconnus, enclavés, et dont la légitimité est bâtie sur la guerre dans une dépendance politique et économique envers Moscou (la monnaie est le rouble russe), les autorités des territoires séparatistes sont mal armées pour gérer la crise. Le système de santé est affaibli notamment par la guerre, un départ massif de médecins et de personnel soignant, et un accès à des équipements compliqué par les frontières. Au plan sécuritaire, la mission spéciale de surveillance de l'OSCE mise en place pour surveiller la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu circulent avec plus de difficultés, souvent interdits de passage par les formations séparatistes, rendant plus difficile à la fois une évaluation de la situation sanitaire et militaire.
Enfin, la crise sanitaire complique les négociations de paix entre Moscou et Kiev, récemment réactivées autour de mesures collaboratives comme l'ouverture de nouveaux points de passage ou le respect de zones de désengagement, créant là aussi un nouvel espace d'incertitude.
Le cas ukrainien de gestion de crise souligne la fragilité de l'État et des populations prises dans une crise sanitaire et sécuritaire mais aussi une forte réactivité, à travers un éventail de pratiques et de politiques. Cependant, au-delà des spécificités de l'entre-deux, de nombreuses préoccupations – régimes des frontières, le déficit d'État social, la répartition des compétences entre pouvoirs central et locaux – sont communes aux sociétés européennes.
Notes
[1] Rey, V. (2013). "Concepts flous pour réalités ambiguës, comment lire la balkanisation dans “l’entre-deux.”" Anatoli (4).
[2] Morris, J. Polese, A. (2016). The Informal Post-Socialist Economy: Embedded Practices and Livelihoods. Routledge.
[3] Pour un article de synthèse en anglais voir “How Volunteers Are Spearheading Ukraine’s COVID-19 Response.” OpenDemocracy. https://www.opendemocracy.net/en/odr/volunteers-ukraine-coronavirus-response/. Un état des lieux de la préparation des établissements de soin a été réalisé par l'initiative REACH du consortium humanitaire ACTED/IMPACT Initiatives en avril 2020 : https://www.impact-repository.org/document/reach/c318fdc8/REACH_UKR_Situation_Overview_RaHFA_April-2020.pdf
- Politik der Kurve: Wissenshistorische Perspektiven auf Produktion und Kommunikation statistischer Evidenz.
- Quand les facteurs de risque ne sont pas intuitifs. L’épidémiologie face à l’histoire
- La Peste et le Corona
- Teil 1: Verstehen und Handeln angesichts der Corona-Krise: Was offenbart die Covid-19-Pandemie über die Herstellung gesundheits- und sozialpolitischer Solidaritäten in Europa (und anderswo)?
- Teil 2: Verstehen und Handeln angesichts der Corona-Krise: Was offenbart die Covid-19-Pandemie über die Herstellung gesundheits- und sozialpolitischer Solidaritäten in Europa (und anderswo)?
- Virale Evolution. Vom worst case und Handlungsimperativen
- État d’urgence sanitaire : les quartiers populaires sous pression policière
- What crisis? Corona as a socio-ecological shock
- L'Ukraine et sa double peine